Rupununi, revisited
Das Takatu-Guesthouse in Lethem, Guyana, fotografiert im Februar 1982. Heute steht da offenbar ein Neubau. (Vgl. Rebellion in der Rupununi, 21.10.2012 sowie Termiten in der Rupununi, 10.07.2011)
Ich habe noch mal in einem meiner alten, manchmal kaum noch leserlichen Reisetagebüchern geblättert. Ich war zwei Mal in der Rupununi-Savanne in Guyana (Südamerika), 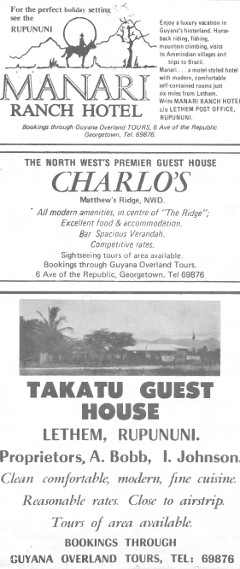 1980 nur in Lethem (die Brücke über den Rio Tacutu gab es noch nicht), und 1982, dann wieder in Lethem und anschließend eine Woche auf der Manari-Ranch (die Piste ist auch „neu“).
1980 nur in Lethem (die Brücke über den Rio Tacutu gab es noch nicht), und 1982, dann wieder in Lethem und anschließend eine Woche auf der Manari-Ranch (die Piste ist auch „neu“).
Beide Aufenthalte waren grandiose und exotische Abenteuer; zur Manari-Ranch möchte ich noch einmal zurückkehren, dann aber mit mehr Zeit (und mehr Geld), um auch das Landesinnere zu erkunden. (Ich würde aber bei einem Dschungel-Trip keine Schwimmwesten anlegen – das wäre mir peinlich.) So etwas macht man allein oder schließt sich den Einheimischen an. (Vgl. Visions of the Interior, 04.09.2003)
Trees and water are among the greatest features of Guyana – two resources to be treasured and preserved for the generations yet unborn. The Guyana forest is not a jungle, it is one of the safer forests of the world, whrer nothing rushes out to attack unless disturbed or trod upon.
In einem Buch über die Geschichte Guyanas heisst es:
Dutch and British colonization made an indelible mark on Guyana, leaving behind a now dilapidated colonial capital, a volatile mix of peoples and a curious political geography. The country’s natural attractions, however, are impressive, unspoiled and on a scale that dwarfs human endeavor. Guyana has immense falls, vast tropical rainforest and savanna teeming with wildlife. If the government doesn’t destroy the environment in a bid to pay off its huge foreign debt, Guyana could be the eco-tourism destination of the future. Right now, it’s the place for independent, rugged, Indiana Jones types who don’t mind visiting a country that everybody else thinks is in Africa.

Rupununi bei Abenddämmerung, in der Nähe der Manari-Ranch
„Bei der Ausreise aus Brasilien werden unsere Rucksäcke nur flüchtig und nur aus Neugierde durchsucht. Die ganze Bande, uns eingeschlossen, fährt im Pickup bis zum mir schon bekannten Fluss. Dort gibt es mittlerweile [im Gegensatz zu 1980] eine Autofähre.
Auf der anderen Seite wartet schon ein Halsabschneider mit einem Auto, das uns im Tacatu-Guesthause absetzt, weil das Immigration Office schon geschlossen hat. Die Fahrt wie im Bilderbuch, ein ratternder Jeep, eine lange Staubfahne auf dem rötlichen Pfad, zartblaue Berge am Horizont, rote Sonne, krüppelige Bäume, Buschwerk und von der Abendsonne angestrahle Termitenhügel.
Das Tacatu hat angebaut. Möbel im Nierentischstil. Weiße Tücher verdecken das Geschirr so lange, bis die Gäste (schon wieder ein „Tropical-Fish“-Händler!) kommen. Wir kriegen nur Tee und zwei Eier, aber nach einer kritischen Bemerkung vom Chef, einem weißhaarigen dicken Neger mit Kolonial-Shorts, bekommen wir zwei halbe knusprige Hähnchen, natürlich nicht umsonst. Der knatternde Generator schräg gegenüber stört etwas. Im Gästebuch in zwei Jahren ca. zehn Deutsche, ich finde noch dein Eintrag von H. und mir vom 4.3.1980. (…)
Am Immigration Office alle sehr freundlich, nachdem wir unsere Erlaubnis vom Konsulat vorgezeigt haben, uns in der Rupununi aufhalten zu dürfen. Wir kaufen noch einen Flug nach Georgetown für nächsten Montag und probieren an einer Erfrischungsbude ein schrecklich schmeckendes Ingwer-Getränk. Bemerkenswert auch der Revolutions-Platz.
Ich quatsche noch mit einem alten Schwarzen, der freundlicherweise den Jeep von der Manari-Ranch anhält: Man hatte uns am Morgen nicht gefunden. Eine halbe Stunde Autofahrt zur Manari, die wie eine Bilderbuch-Ranch zwischen riesigen (Avocado?) Bäumen liegt wie ein Heidehof. Termitenhügel – bis zu dreieinhalb Meter hoch in der kargen, mit Buschwerk bestandenen Landschaft. Viel Sand und Pflanzen, die sich durch den harten Boden wühlen.
Vier Mal am Tag ausgezeichnetes Essen, Frühstück mit Pampelmusen. Mittags zwei Sorten Fleisch, Salat und viel Gemüse. Lunch: es gibt Empanada-ähnliche Brote und Käse und Marmelade. Am Abend: ein Dienstmädchen kündigt höflich an „the dinner is ready, Sir“, wieder zwei Sorten Fleisch mit Birnen etc. Kein Bier, keine Cola – ist aber auch nicht nötig. Es ist wie im Paradies und kostet uns nur wenig, weil wir uns in Brasilien – nicht ganz legal und für einen unglaublich günstigen Kurs – mit Guyana-Dollar eingedeckt haben [die Einfuhr von Guyana-Dollar war verboten, aber wir hatten das Geld trotzdem reingeschmuggelt.]
Nebenan ein kleiner Fluss, aus dem das Wasser für die Ranch kommt. Wir kriegen ein Boot, aber S. wird beim Schwimmen von irgendetwas gebissen. Wir gehen besser nicht mehr ins Wasser.
Der Kanadier, einer der wenigen Gäste, erzählt: Vor dem Aufstand [1969] waren die Rancher in der Rupununi unermesslich reich, einer hatte 6.000 Pferde (sie wollen die mit US-amerikanischen Rasse-Pferden kreuzen) und 4.000 Rinder. Alle Flugplätze – bis auf den der Manari-Ranch – waren geschlossen. Die Soldaten, die auch noch jetzt [1982] klauten wie die Raben, schlachteten das meiste Vieh oder transportierten es nach Georgetown.
Die Ureinwohner (Amerindios) leben in Hütten mitten in der Savanne und verkaufen, jetzt für viel Geld, Töpferwaren und Hängematten. Die Regierung steckte sie in Reservate, um sie kontrollieren zu können. Jede Familie besitzt einen Hund, den nicht nicht füttert (alle anderen Hunde schon).
Die Hausmädchen sprechen ihre eigene Sprache und vermuten, wie sie uns schüchtern versuchen mitzuteilen, dass wir „sehr reich“ seien. Ihre Vorfahren, sagt man auf der Ranch, seien Kopfjäger aus dem Amazonas-Gebiet gewesen. Ein Schotte war auch mit seinen Genen dabei.
Der Rancher lästert beim allabendlichen Plausch über die ausländischen Botschaften in Georgetown: Die Russen führen den ganzen Tag mit schweren schwarzen amerikanischen Chevrolets umher. Die Kubaner lägen nur in den Fenstern und guckten den Leuten zu. Die Chinesen hätten eine Mauer gebaut, so dass man noch nicht einmal den ersten Stock sehen könne. Die Briten hätten jeden Tag eine Party. Der Botschafter der DDR sei mit einer Zahnärztin verheiratet gewesen, ist jetzt wieder geschieden.
Wir haben abwechselnd Durchfall und bekommen fettlose Süppchen zum auskurieren. Ich paddele mit dem Boot umher, bis das Wasser zu niedrig wird, und hole mir einen entsetzlichen Sonnenbrand, obwohl ich sowieso schon braungebrannt bin. Am Sonntag bekommen wir Pferde gestellt und reiten ein wenig umher, aber die Gäule sind sehr müde.
Wir beschließen, nicht nach Surinam zu reisen. Wir werden auch zum Karneval in Trinidad ankommen, so dass wir dort kaum eine bezahlbare Unterkunft finden werden. Der Plan also: von Georgetown sofort nach Tobago…“
Haec arbor a me alienum puto
Fotografiert 1982 in Georgetown, Guyana. Die Dame im Baum ist meine damalige Freundin. Leider weiß ich nicht, welche Baumart das ist. Vielleicht lesen hier Botaniker mit?
An die Nachgeborenen über die Zeiten
Die Rupununi-Savanne im Westen Guyanas in der Trockenzeit (Symbolbild für regenarme Zeiten)
… Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden
Saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich.
So verging meine Zeit
Die auf Erden mir gegeben war.
Die Kräfte waren gering. Das Ziel
Lag in großer Ferne
Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich
Kaum zu erreichen.
So verging meine Zeit
Die auf Erden mir gegeben war.
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut
In der wir untergegangen sind
Gedenkt
Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht
Auch der finsteren Zeit
Der ihr entronnen seid.
Gingen wir doch, öfter als die Schuhe die Länder wechselnd
Durch die Kriege der Klassen, verzweifelt
Wenn da nur Unrecht war und keine Empörung.
Dabei wissen wir ja:
Auch der Haß gegen die Niedrigkeit
Verzerrt die Züge.
Auch der Zorn über das Unrecht
Macht die Stimme heiser. Ach, wir
Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit
Konnten selber nicht freundlich sein.
Ihr aber, wenn es soweit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.
(Bertolt Brecht: An die Nachgeborenen, entstanden 1934-38)
„An die Nachgeborenen“ gehört für mich zu den Top Ten aller Gedichte seit dem Gilgamesch-Epos. Ich wüsste gern, ob das im deutschen Schulunterricht Thema ist und wie Lehrer mit den Worten „durch die Kriege der Klassen“ umgehen?! Vermutlich sagen sie, dass es damals so war, heute aber nicht – oder irgendeinen anderen Kapitalismus-affinen Unsinn.
Ich wüsste auch gern, was der wortgewaltige Dichter zu Gendersprache sagen würde: „Daß der Mensch dem Menschen ein/e Helfer*_In ist“? Da merkt man, wie bekloppt solche Leute sind. Aber verzerrte Züge hat der protestantische Furor der neuen deutschen grünen Mittelschicht schon, wenn es um Volkspädagogisches geht. Man müsse sich sprachlich benehmen. Wer das nicht kann, gehört nicht zu den Guten und muss zukünftig Fleischwurst und Eier von Hühnern aus Legebatterien essen.
Gedenkt unsrer mit Nachsicht. Großartig! Pathetisch wie Homer, ohne in Kitsch abzugleiten. Werde ich mir für meine Nachfahren merken, falls sie mir zuhören….
Rätsel für Ornithologen
Guyana Zoological Park, Georgetown, 1982. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welche Vögel das sind – beide sehen wie Geier aus. Da müssen Ornithologen ran!
Amerindios, revisited
Ein traditionelles Haus der Amerindios aus Guyana, fotografiert in Georgetown in einem Freilichtmuseum 1982. (Die Frau im Vordergrund ist meine damalige Freundin.)
In Guyana leben 6.000 Wapishana (diemeisten in der Rupununi-Savanne), 15.000 Arawak, 5.000 Akawaio, 5.000 Patamona, 7.000 Makushi und rund 200 Waiwai. Ethnologisch ist Guyana ein sehr interessantes Land; der Essequibo steht auf meiner To-Do-Liste.
Ich habe kein Foto des obigen Hauses im Internet wiedergefunden. Es gibt zwar Bilder aus der südlichen Rupununi und von traditionellen Siedlungen der Wapishana aus der Nähe von Lethem, aber keine aus Georgetown. Vielleicht bin ich der einzige Mensch, der davon ein Foto gemacht hat.
Guyana Zoological Park
Guyana Zoological Park, 1982
Vorschau Paddeln
Da ich in Kürze mit meinem Kajak die Berliner Gewässer unsicher machen werde, möchte ich die verehrte Leserschaft der Sorge entheben, ich würde untergehen, ersaufen oder sonstwie verunglücken. Ich bin des Paddelns mächtig und habe 1982 in Guyana geübt, unweit der Manari-Ranch in der Rupununi-Savanne.
Essequibo River
Flug über das Delta des Essequibo River in Guyana auf dem Weg von Georgetown nach Port of Spain/Trinidad (1982).
Rio Branco
Der Rio Branco nordwestlich von Boa Vista, Roraima, Brasilien (ungefähr hier). Das Foto habe ich 1980 gemacht. Damals war Boa Vista ein verschlafenes Nest, ganz ohne Touristen. Die Berge im Hintergrund sind die Kanuku Mountains in Guyana.
Als ich neulich aus dem Fenster sah
Als ich neulich aus dem Fenster und die grauen Mauern gegenüber sah und das bescheidene Wetter missbilligte, fragte ich mich, warum ich nicht woanders wohne. Natürlich ist Berlin-Neukölln Rixdorf eines der interessantesten Stadtviertel, in dem man zur Zeit in Deutschland wohnen kann, und ich habe Verwandte und Freunde in Berlin. Aber möchte ich das letzte Drittel meines Lebens hier verbringen? Der Vergleich ist ein bisschen verwegen, aber Rixdorf könnte man nur toppen mit Jerusalem oder Hongkong.
Und was möchte ich sehen, wenn ich alt und klapprig bin und vielleicht 95? Immer noch Rixdorf? Ich lebe mit keiner Frau zusammen und habe keine Kinder, beide Themen sind abgehakt. Das Geld, um mich abzuseilen, habe ich im Moment auch nicht. Schnelles Internet müsste aber schon sein.
Mein Traumziel, die Karibik-Küste Kolumbiens, habe ich noch nicht aufgegeben, obwohl dieselbe (sic) Küste in Venezuela weniger stressig wäre (äh… Drogenschmuggel und so, empfehlenswert nur für erfahrene Globetrotter) und die Frauen genauso ultraschön. Aber ich mag die Kolumbianer.
Einer der schönsten Gegenden, wo ich jemals war, ist aber zweifellos der Westen Guyanas in der Nähe der brasilianischen Grenze, nicht remote access, sondern eine im Sonne des Wortes wirklich remote area. Lonely Planet schrieb:
Dutch and British colonization made an indelible mark on Guyana, leaving behind a now dilapidated colonial capital, a volatile mix of peoples and a curious political geography. The country’s natural attractions, however, are impressive, unspoiled and on a scale that dwarfs human endeavor. Guyana has immense falls, vast tropical rainforest and savanna teeming with wildlife. (…) Right now, it’s the place for independent, rugged, Indiana Jones types who don’t mind visiting a country that everybody else thinks is in Africa.
Yeah. Well said, dude.
Vermutlich würde ich aber dort bald vieles vermissen, vor allem meine Freunde, oder auch meinen jährlichen Besuch in meiner alten Heimat (vgl. unten). Wenn ich jedoch noch einen Bestseller schriebe und das Flugticket Berlin-Georgetown aus der Portokasse bezahlen könnte, dann werde ich mir das noch einmal überlegen. Oder ich müsste eine reiche, kluge und reiselustige Frau kennenlernen, die alles bezahlte.
Das obere Foto zeigt den Blick von der Manari-Ranch auf die Rupununi-Savanne in Guyana (1982). Das untere Foto zeigt den Emscherquellhof in meinem Heimatort Holzwickede im Ruhrgebiet, aufgenommen an der Kreuzung Hauptstraße/Lünschermannsweg (2012). Im Hintergrund der Hixterwald, in dem ich als kleiner Junge mit meinem Großvater oft war.
Rebellion in der Rupununi
Die Fotos habe ich 1982 in der Rupununi-Savanne im Südwesten Guyanas gemacht.
Die Manari-Ranch in der Rupununi-Savanne im Westen Guyanas wäre ein Paradies, sähe man nur flüchtig hin. Der Blick aus den ebenerdigen Gästezimmern streift über dunkelrote und schwer duftenden Blüten zu den blauen Bergen am Horizont und verliert sich zwischen den knorrigen Bäumen, die irgendwie verschüchtert aussehen, als trauten sie sich nicht, zu einem orgentlichen Wald zusammenzuwachsen. Der Herren der Savanne sind die Termiten. Ihre zum Teil über mannshohen Bauten thronen über der Ebene wie Burgen. Dazwischen grellbunte Orchideen; man kann stundenlang spazierengehen, ohne einen Menschen oder ein Tier zu sehen – ausser Vögeln oder Gewürm. Die Termiten besetzen manchmal Bäume und funktionieren sie zu ihren Häusern um. Der Rancher erzählt, dass der Baum garantiert sterben müsse, die einzige Gegenwehr gegen Termiten sei Feuer.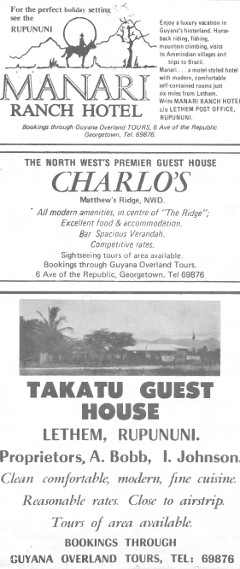 Wer kennt schon das Gefühl, ausgerechnet in Guyana zu reisen? Es liegt fernab der Touristenströme. Und doch stellt sich das Gefühl besonders intensiv ein, ganz da zu sein und doch verloren wie ein Wassertropfen im Ozean. Man weiß nicht so recht, wo man eigentlich ist. Wir reiten auf den Pferden der Ranch stundenlang durch die Savanne und sind ganz allein dort. Die Ranch liegt wie eine Insel im Meer der Ebene. Wer waren wohl die Leute, die sie errichtet haben? Wann und warum gerade hier? Die verwitterten Holzkreuze erzählen nicht viel. Man ist abgeschnitten von der Welt. Hier gibt es keine Obrigkeit, keine Bürokratie, niemand, der etwas anordnen kann, ausser denen, die hier etwas besitzen. Eine verlockende Vorstellung, mit den fremden Sternen am Nachthimmel und am Tag den Blick auf unbekannte Berge, hinter denen Geheimnisse verborgen zu sein scheinen….
Wer kennt schon das Gefühl, ausgerechnet in Guyana zu reisen? Es liegt fernab der Touristenströme. Und doch stellt sich das Gefühl besonders intensiv ein, ganz da zu sein und doch verloren wie ein Wassertropfen im Ozean. Man weiß nicht so recht, wo man eigentlich ist. Wir reiten auf den Pferden der Ranch stundenlang durch die Savanne und sind ganz allein dort. Die Ranch liegt wie eine Insel im Meer der Ebene. Wer waren wohl die Leute, die sie errichtet haben? Wann und warum gerade hier? Die verwitterten Holzkreuze erzählen nicht viel. Man ist abgeschnitten von der Welt. Hier gibt es keine Obrigkeit, keine Bürokratie, niemand, der etwas anordnen kann, ausser denen, die hier etwas besitzen. Eine verlockende Vorstellung, mit den fremden Sternen am Nachthimmel und am Tag den Blick auf unbekannte Berge, hinter denen Geheimnisse verborgen zu sein scheinen….
Abends sitzen die wenigen Gäste des Hotels mit der Rancherfamilie auf der Terasse zusammen und plaudern. Meine damalige Freundin und Reisepartnerin war Ethnologin, und wir hatten vor der Reise alle verfügbare Literatur über Guyana gelesen. Viel war es nicht, aber in einer Fachzeitschrift stand etwas von einem Aufstand in der Rupununi. Irgendwann merkte der Rancher, dass wir mehr wussten als gewöhnliche Reisende. Und als ich ihm eine Kopie des besagten Artikels gab, verschwand er für eine Weile in einem Hinterzimmer. Etwas erregt kam er wieder zurück, und war von der Idee nicht mehr abzubringen, dass ich ein writer sei, der inkognito reise. Heute gibt es einige Quellen online über das Rupununi Uprising – eine vergessene Geschichte eines von der Welt vergessenen Landes:
On January 2, 1969, the police station at Lethem, the administrative center of the Rupununi District, was attacked by ranchers, mainly from the Hart and Melville families, who were armed with bazookas and automatic weapons. Lethem Police Station was completely wrecked by bazooka shells and policemen were riddled by bullets as they tried to escape. Annai and Good Hope stations were seized and the personnel held captive along with other Government officials and civilians in the abbattoir at Lethem.
Five policemen and one civilian were killed, the government dispenser was shot and wounded, and a number of persons, including the District Commissioner and his wife, were herded into the abbattoir and held hostage. News about the insurrection reached Georgetown by midday that day and policemen and soldiers were flown in to Manari by Guyana Airways. When the government forces moved on Lethem the rebels fled, eventually going across the border.
Damals lockte das ölreiche Venezuela, das immer noch den ganzen Westen Guyanas für sich reklamiert. Als ich vor ein paar Jahren in Caracas eine Karte Venezuelas kaufte, wunderte ich mich, dass das Land im Osten wesentlich grösser war als auf allen Karten, die es in Deutschland von Südamerika gibt.
Aus meinem Reisetagebuch: „Der Kanadier erzählt, vor der Aufstand wären die Rancher unermesslich reich gewesen, bis zu 6000 Pferde und 4000 Rinder wären auf einer Ranch gewesen. Sie hätten vorgehabt, die Pferde mit amerikanischen Rassepferden zu kreuzen. Alle Flugpisten bis auf die der Manari-Ranch seien geschlossen worden. Die Soldaten aus Georgetown, die jetzt noch klauten wie die Raben, schlachteten das meiste Vieh oder transportierten es an die Küste…
Die Amerindians leben in Hütten mitten in der Savanne und verkaufen, jetzt für viel Geld, Töpferwaren. Die Regierung steckt sie in Resevate, um sie kontrolieren zu können. Jede Familie hat unter ihren Hunden einen, den sie nicht füttert. …Die Hausmädchen sprechen ihre eigene Sprache und vermuten, wir wären sehr reich. Ihre Vorfahrenerzählen sie, seien head hunter aus dem Amazonas-Gebiet, einer sei auch ein Schotte gewesen….
Abends auf der Veranda weitere Geschichten: die Botschaften in Georgetown seien ein Grund zur Belustigung: Die Russen führen den ganzen Tag mit schweren amerikanischen Chevrolets umher, die Kubaner lägen nur in den Fenstern und schauten den Leuten zu, die Chinesen hätten eine so hohe Mauer gebaut, dass man noch nicht einmal das erste Stockwerk sehen könnte. Die Engländer feierten jeden Tag eine Party. Der Botschafter der DDR sei mit einer Zahnärztin verheiratet.“
Das Guyana Journal schreibt: „The insurrection was organized by a number of private ranchers who believe that Burnham’s government would refuse to renew their grazing rights and they were actively aided by a small number of Amerindians.“
Die Fronten sind sehr merkwürdig: Weiße Rancher, also Großgrundbesitzer, zusammen mit indianischen Ureinwohnern, gegen Einwanderer aus Indien und Nachfahren afrikanischer Sklaven, erstere unterstützt von Venezuela, letztere von den Engländern. Der Konflikt ist vergleichbar mit dem zwischen Belize und Guatemala.
The ringleaders of the insurrection fled across the border into Brazil and Venezuela, where they claimed that they had intended to set up an independent Rupununi Republic. The Guyana Government declared the Rupununi restricted and murder charges were brought against fifty-seven persons, twenty-nine of whom obtained asylum in Venezuela or Brazil. The remaining twenty-eight were taken to Georgetown. Charges were withdrawn against eighteen and the remaining ten, who were mostly Amerindians, were later either released or acquitted. In his statement on the revolt, Mr. Burnham accused Venezuela of arming and training the rebels.
Wie es heute aussieht, beschreibt ein Artikel Thomas William Henfreys von der University of Kent at Canterbury:
The Rupununi ranching industry has since its establishment provided employment, and more recently a means of independent livelihood, for Wapishana people. Despite the massive decline of the industry following the Rupununi uprising in early 1969, it continues to exert a profound effect on their lives. Cattle are reported to be kept in every Wapishana village, and a few individuals have set up as independent ranchers. The most enduring influence has been the ongoing conflict with the Rupununi Development Company, whose massive land holdings in the south-central savannas literally fenced in several Wapishana communities.
Die Stabroek News spricht sogar von einer „Revoluton“. Der Chef der sozialistischen Guyana Action Party, Paul Hardy – die GAP hat sich mit der sozialdemokratischen und Working People’s Alliance zusammengeschlossen -, fördert die grenzüberschreitende Kooperation mit Brasilien.
Langer Rede kurzer Sinn: Die Linken haben in Guyana nicht nur gewonnen, sondern bringen das Land nach langen Jahren der Wirren auf Kurs. Und das ist doch mal eine gute Nachricht.
The place for independent, rugged, Indiana Jones types
Die Fotos habe ich 1982 in Georgetown, Guyana, gemacht.
Wenn man etwas über Guyana erzählen will, greifen die Gesprächspartner zur nächsten Landkarte. Mittelamerika? Nein, Süd, dort wo die Franzosen ihre Raketen starten? Auch falsch, das ist Französisch-Guyana und Teil Frankreichs. Und Surinam ist das ehemalige holländische Guyana. Wer das vormals britische Guyana kennt, erinnert sich vielleicht an den Massenselbstmord von Jonestown. Nur zum Mitschreiben: Guyana ist das einzige englischsprachige Land Südamerikas. Die Kaieteur-Wasserfälle sind um ein Dreifaches grösser als die Niagara-Fälle. Und auch sonst ist Guyana ein Geheimtipp. Ich bin zwei Mal dort gewesen, beim ersten Mal, 1979, ohne Kamera, weil ich in Brasilien mit derselben in einen Fluss – den Rio Branco gefallen war…
Nach Guyana reist man nur über zwei Wege: direkt mit dem Flugzeug nach Georgetown oder über den Nordosten Brasiliens. Ich bin von Manaus am Amazonas nach Boa Vista im brasilianischen Bundestaat Roraima gefahren, die Stadt, in der Papillon nach seiner Flucht von der Teufelsinsel Zuflucht suchte. Damals, 1979 und 1982, war der Ort ein verschlafenes Nest: Der Goldrausch in Roraima hatte noch nicht begonnen.
Ein vergilbtes kleines Schild der Guyana Airways Corporation hängt hinter mir an meinem Bücherregal: Baggage Tag steht darauf. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ziemlich viele Guyana Dollar für das Übergewicht meine Rucksackes zahlen musste. Kleine, unwichtige Ereignisse, die Gefühle auslösen, Erinnerungen, den Wunsch, dorthin zu reisen und nachzusehen, was sich seitdem geändert hat. Die Fluggesellschaft gibt es nicht mehr, alle Flüge wurden eingestellt. Heute fliegt Trans Guyana Airways die kleine Orte abseits der Küste an.
Von Lethem in der Rupununi-Savanne flogen wir nach Georgetown, der Hauptstadt Georgetowns. Das Wahrzeichen Georgetowns ist der Stabroek Market (Bild oben), dessen schöner Turm das Stadtzentrum überragt. Über den historischen Stabroek Market heisst es auf der Website des National Trust – so etwas wie der Denkmalschutz von Guyana:
This ward of the city of Georgetown has an oblong form being one fourth of a mile broad and one mile long. It was established by the French in 1782 on the Company’s reserve and was named by the Dutch after Nicholas Gleevinck; Lord of Stabroek, the then President of the Dutch West India Company in 1784.
Die Stadt hieß früher Stabroek und wurde erst 1812 umbenannt. Wer eine exotische Mischung aus französischer, holländischer und englischer Architektur des 19. Jahrhunderts sehen will, ist in Georgetown gerade richtig.
1982 quartierte ich mich im Rima im Stadtteil Cummingsburg ein, in genau demselben Guest House, in dem ich schon 1979 eine Woche verbracht hatte – ein altes zweistöckiges Haus (2. Foto von oben, linkes Haus) im colonial style; es gab englisches Frühstück und strenge Ermahnungen des grauhaarigen schwarzen Besitzers, der um seine Gäste besorgt war, keine Fremden mitzubringen und in der Stadt extrem vorsichtig zu sein. Falls jemand der wohlwollenden Leserinnen und geneigten Leser jemals nach Guyana kommt: das Rima Guest House ist erste Wahl und unter Hardcore-Globetrottern als Treffpunkt in Georgetown beliebt.
Aus dem Fenster blickte ich direkt auf die Botschaft von Trinidad und Tobago (3. Bild links). Imposant war die St. George’s Cathedral, eines der höchsten, wenn nicht das höchste Holzhaus der Welt (5. Foto). Ein sehenswertes und filigranes Gebäude ist die City Hall (4. Bild rechts) – ein Muss für jeden Reisenden in Georgetown.
Leider ist die Sektendichte in Georgetown ungefähr so wie in den USA. In manchen Stadtvierteln ist jedes dritte Haus irgendein religiöser Versammlungsort. Am kleinen Hafen schrie mir ein Schild entgegen: Be a muslim now!
1979 schlenderte ich mit meinem damaligen Reisepartner dort entlang, wir sahen Hafenarbeitern zu, die Schiffe entluden. Zwei Weiße erblickten uns und riefen uns zu: „May we help you?“ Sie hielten uns wohl für Amerikaner und lachten sich darüber kaputt. Wir verstanden aber ihr Sächsisch – es waren Ingenieure aus der DDR. Als wir in Deutsch antworteten, waren sie völlig verblüfft, wollten aber nicht mit uns reden. Guyana kooperierte damals mit sozialistischen Staaten. Bei meiner zweiten Reise 1982 konnte ich im Zoo Georgetowns eine Ausstellung über „30 Jahre DDR“ bewundern. Dafür hätte ich nicht nach Südamerika reisen müssen…
Direkt vor der US-Botschaft (Bild unten) musste ich mich mit einem Straßenräuber prügeln. Ich hielt eine Flasche Rum in der Hand, die ich gerade gekauft hatte, als jemand mir von hinten einen Arm den Hals legte und mit dem anderen versuchte, in meine linke Hosentasche zu greifen, wo ich eine kleine Kamera hatte. Ich hätte ihm mit der Flasche auf den Kopf schlagen können, aber irgendwie verspürte ich keine Angst, sondern warf sie auf den Rasen – schon mit dem Gedanken, es sei schade um den schönen Rum. Wir rangen ein wenig herum, waren wohl beide gleich stark. Als ich versuchte, dem Räuber in das Gemächt zu greifen, liess er von mir ab und rannte davon. Der einzige Versuch eines Überfalls, den ich während meine Reisen in Südamerika – insgesamt mehr als zwei Jahre – erlebt habe.
In einem Buch über die Geschichte Guyanas heisst es:
Dutch and British colonization made an indelible mark on Guyana, leaving behind a now dilapidated colonial capital, a volatile mix of peoples and a curious political geography. The country’s natural attractions, however, are impressive, unspoiled and on a scale that dwarfs human endeavor. Guyana has immense falls, vast tropical rainforest and savanna teeming with wildlife. If the government doesn’t destroy the environment in a bid to pay off its huge foreign debt, Guyana could be the eco-tourism destination of the future. Right now, it’s the place for independent, rugged, Indiana Jones types who don’t mind visiting a country that everybody else thinks is in Africa.
Ich habe hier noch einen fast verblassenen Fotoband von Robert J. Fernandes, einem Fotografen aus Georgetown, über den Google nur einen Link findet. Visions of the Interior heisst das schmale Buch mit einem Einband aus Pappe: zwei Dutzend Fotos der Wasserfälle im Innern Guyanas – Fotos von überwältigender Schönheit.
Guyana ist etwas für echte Globetrotter: Ich spüre die Riemen des Rucksacks auf meinen Schultern knirschen, höre das sanfte Plätschern, wenn der Aussenborder mit halber Kraft das Boot einen schmalen Flussarm aufwärts treibt, höre die durchdrehenden Reifen eines Jeeps, der in einem Wasserloch feststeckt, die Propeller eines kleinen Flugzeugs, das in sanftem Bogen über die Savanne fliegt, die Abendsonne im Hintergrund, sehe die Termitenhügel der Rupununi und die blauen Berge der Guyana Highlands.
Wenn es sich irgendwie machen lässt, werde ich nach Guyana zurückkehren.
Termiten in der Rupununi
Das Foto wurde 1982 in der Rupununi-Savanne in Guyana (Südamerika) gemacht. Wer in Biologie gefehlt hat: Ich stehe da vor einem Termitenhügel (Manari-Ranch, östlich von Lethem).
Das grosse Flughafen-Quiz auf burks.de
Ihr könnt es eh nicht herausfinden – nur der Flughafen in Havanna/Kuba (1984) dürfte klar sein oder das zweite Foto – das ist der Tocumen International Airport in Panama (1981). In Panama habe ich Silvester 1981/82 verbracht.
Den dritten Flughafen gibt es gar nicht mehr: Es ist der winzige Airport Grenada Pearls der Antillen-Insel Grenada (1982). Der heutige Flughafen ist nach dem Revolutionär und ehemaligen Ministerpräsidenten Maurice Bishop benannt.
„Sein Bau wurde von den USA allerdings als Zeichen interpretiert, dass Grenada damit zum militärischen Vorposten der Sowjetunion ausgebaut würde. Daher landeten im Oktober 1983 im Rahmen der Operation Urgent Fury Fallschirmspringer und brachten ihn unter ihre Kontrolle.“ Der Flughafen diente den USA also zum Vorwand, um die linke Regierung von Grenada zu stürzen. Ich vergesse so etwas nicht – immerhin war ich Augenzeuge der Revolution in Grenada.
Flughafen Nummer vier liegt in Georgetown, der Hauptstadt Guyanas (1982). Wenn man sich das Gelände heute von oben anschaut, scheint sich nicht viel geändert zu haben. Ich war zwei Mal in Guyana und bin beide Male mit der Guyana Airways Corporation geflogen, die eine bewegte Geschichte hat:  „In the 1980s Guyana Airways Corporation’s domestic operations started to deteriorate for a number of reasons, not least among them the unrealistically low fares it was required to charge and the lack of access to foreign exchange for imported aircraft parts and other requirements. The private sector therefore began to fill the gap and by 1991 three major domestic charter operators had emerged. In the meantime, Guyana Airways Corporation’s domestic service continued to deteriorate and, by 1993, possessed only one Twin Otter DHC-6 to service the entire country“.
„In the 1980s Guyana Airways Corporation’s domestic operations started to deteriorate for a number of reasons, not least among them the unrealistically low fares it was required to charge and the lack of access to foreign exchange for imported aircraft parts and other requirements. The private sector therefore began to fill the gap and by 1991 three major domestic charter operators had emerged. In the meantime, Guyana Airways Corporation’s domestic service continued to deteriorate and, by 1993, possessed only one Twin Otter DHC-6 to service the entire country“.
Haha. Das Luftwesen Guyanas machte schon damals keinen guten Eindruck auf mich. Der zweite Flughafen von unten ist der in Annai bzw. Mahdia in Zentral-Guyana. (Ja, ist schon gut, es handelt sich nicht um einen Flughafen, sondern um einen „Landeplatz“. So sah das auch aus.) Damals gab es noch keine Straße, die die Savanne an der Grenze zu Brasilien mit der Hauptstadt an der Küste verband. Das Hubschrauberwrack auf der Landebahn beruhigte die wenigen Fluggäste auch nicht gerade. Guyana ist ein echter Geheimtipp (ja, ich habe schon vor acht Jahren einmal darüber gebloggt). Ich hoffe, dass ich in meinem Leben noch einmal auf eine Entdeckungstour ins Landesinnere gehen kann.
Auch der letzte Flughafen ist nicht zu erraten – er gehört zur kleinen Insel San Andres (1979 fotografiert), die vor der Küste Nicaraguas liegt, aber erstaunlicherweise zu Kolumbien gehört. Ich kriege schon wieder Fernweh….
Reggae Fever
Gesehen und fotografiert 1982 in Georgetown, Guyana, Südamerika

































































