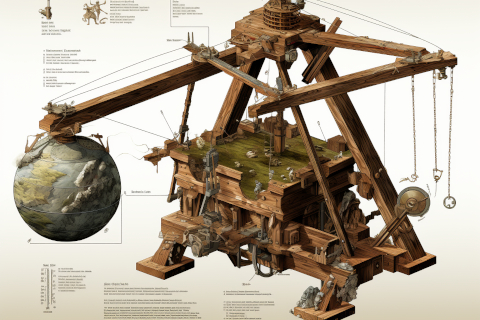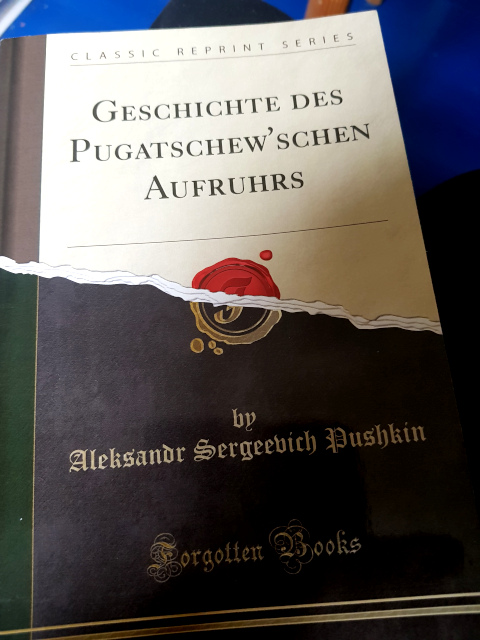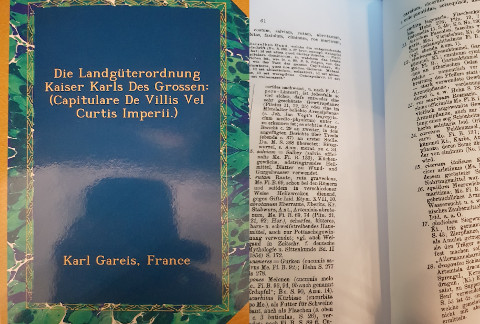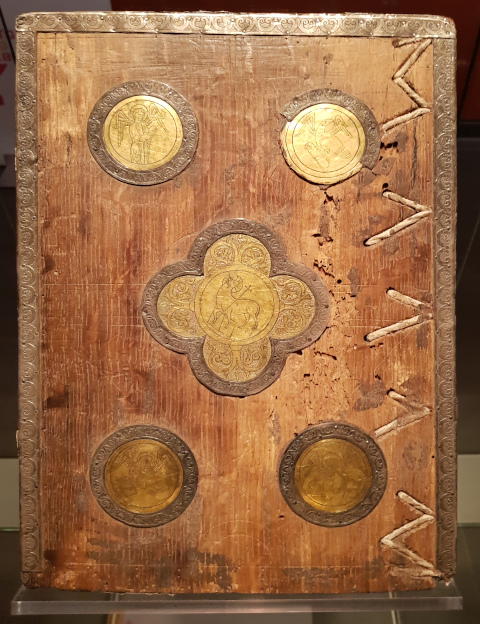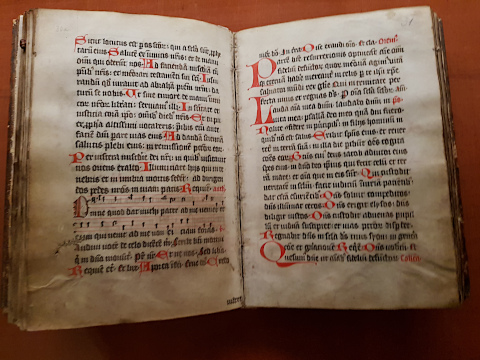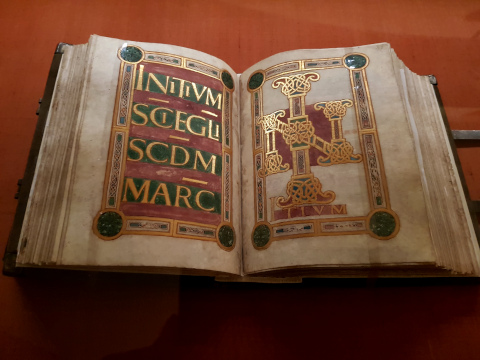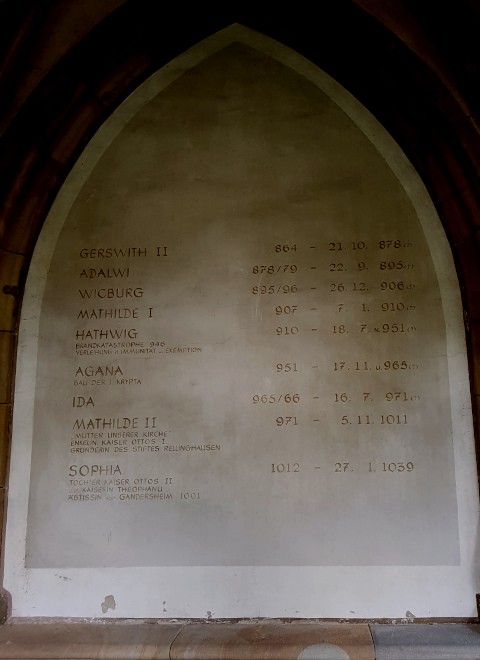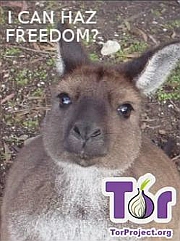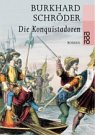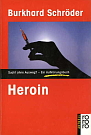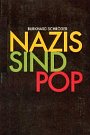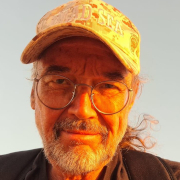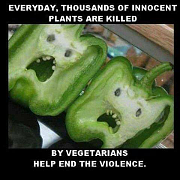Religionsfreier Beitrag zur Weltkultur
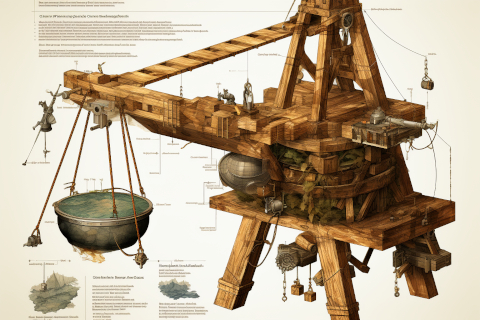
[URL des hochgeladenen Bilds „Leonardo da Vinci Rotatable Crane. 3D Rendering Illustration of Leonardo da Vinci desing and invention of Rotatable Crane“] Create an illustration depicting Leonardo da Vinci’s mid-journey wooden::3 lever crane design. Capture the scene with meticulous attention to detail, showcasing the crane in action as it lifts a heavy load amidst a bustling Renaissance-era construction site. Let the intricate mechanics of the crane shine through, highlighting Leonardo’s innovative engineering prowess, realistic yet stylized, historical, green and amber, raw materials, outlandish energy, rounded –ar 3:2 –s 750
Ich bin niemals ein berufsmäßiger Journalist gewesen, der seine Feder an den Meistbietenden verkauft und ständig lügen muß, weil die Lüge zum Beruf gehört. Ich war immer ein völlig freier Journalist, habe immer dieselbe Meinung vertreten und habe nie meine tiefsten Überzeugungen verbergen müssen, um den Vorgesetzten oder ihren Handlangern zu gefallen. (Antonio Gramsci, 12.10.1931)
Ich habe Antonio Gramscis Briefe aus dem Kerker gelesen. Die Briefe sind eher privater Natur und sagen mehr über den Mann aus, der über Jahre im Gefängnis des faschistischen Italiens saß. Man sollte Gramsci aber kennen, um das Italien von heute einschätzen zu können. Von den italienischen Kommunisten, die Gramsci mit gründete, ist nichts außer ein paar jämmerlichen Politsekten übrig geblieben, genauso wie von den deutschen Kommunisten.
In den Briefen habe ich ein ein paar interessante Zitate gefunden über die italienische Geschichte, Religion und Juden.

create an illustration depicting Leonardo da Vinci’s mediaval Renaissance wooden lever crane design. Capture the scene with meticulous attention to detail, showcasing the crane in action as it lifts a heavy load amidst a bustling Renaissance-era construction site. Let the intricate mechanics of the crane shine through, highlighting Leonardo’s innovative engineering prowess, realistic yet stylized, historical, green and amber, raw materials, outlandish energy, rounded –ar 3:2 –version 6.0 –s 750
Italienische Geschichte
Von diesem Begriff der Funktion der Intellektuellen aus wird meiner Meinung nach auch der Grund oder einer der Gründe des Verfalls der mittelalterlichen Stadtstaaten deutlich, d.h. der Herrschaft einer ökonomischen Klasse, die es nicht verstand, sich eine eigene Kategorie von Intellektuellen zu schaffen und über die Zwangsherrschaft hinaus eine Hegemonie auszuüben. Die italienischen Intellektuellen besaßen keinen volkstümlich-nationalen, sondern einen kosmopolitischen Charakter nach dem Vorbild der Kirche, und Leonardo [da Vinci] verkaufte ohne Bedenken dem Herzog Valentino [a href=“https://de.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia“>Valentinois] die Zeichnungen der Festungsanlagen von Florenz. Die Stadtstaaten repräsentierten also einen syndikalistischen Zustand, dem es nicht gelang, über sich hinauszuwachsen und zu einem integralen Staat zu werden, wie in vergebens Machiavelli anstrebte, der mit Hilfe der Organisation des Heeres die Hegemonie der Stadt über das Land ausüben wollte und deshalb der erste italienische Jakobiner genannt werden kann (der zweite war Carlo Cattaneo, aber mit zuviel verrückten Ideen im Kopf). Aus alledem wird deutlich, dass die Renaissance als eine reaktionäre und repressive Bewegung betrachtet werden muss. (Antonio Gramsci, 17.08.1931)
Das ist eine erstaunliche, aber sehr interessante These. Dahinter lauert die hier schon mehrfach erörterte, aber bisher ungelöste Frage: Warum entstand der Kapitalimus, der alsbald den ganzen Weltball kolonialistisch bzw. imperialistisch überrollte, ausgerechnet in Nordwesteuropa und nicht etwa in Italien, auf dem Gebiete des ehemaligen Weltreichs Rom und der Renaissance, die die herausragendsten Künstler und Intellektuellen der vor- bzw. frühkapitalistischen Zeit hervorgebracht hatte?
Wenn ich Gramsci richtig verstehe, fragt er, warum sich der Nationalstaat nicht aus den italienischen Stadtstaaten wie Venedig entwickelt habe – eine Großmacht, die sogar Kolonien besaß und dessen Handelsgüter bis nach Alaska gelangten?
Gramsci geht also davon, dass es eines Nationalstaates – der in Westeuropa aus dem Absolutismus hervorging – bedarf, damit die ökononomische Entwicklung in Richtung Kapitalismus in Schwung kommt – also von der Manufaktur zur Fabrik.
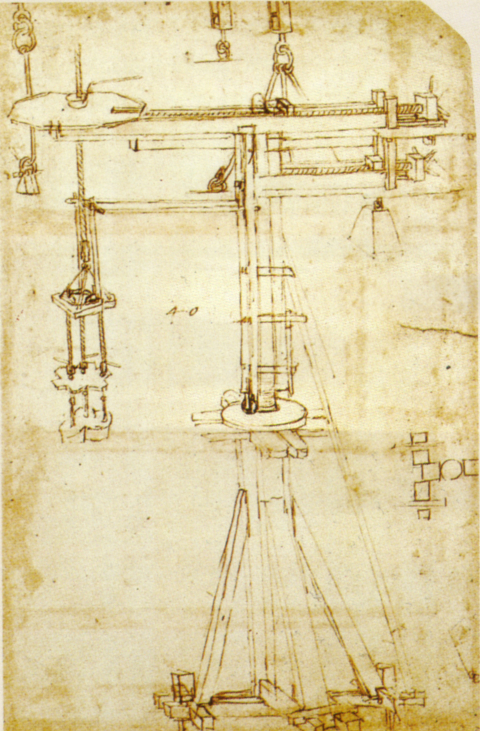
Leonardo da Vinci: Gru girevole di brunelleschi, codice ambrosiano CA (gemeinfrei), ca. 1490
Religion
…wir nahmen ganz oder teilweise an der Bewegung der moralischen und intellektuellen Reform teil, die in Italien von Benedetto Croce propagiert wurde und die in erster Linie darin bestand, dass der moderne Mensch ohne Religion leben kann und muss, und das bedeutet: ohne geoffenbarte oder positive oder mythologische Religion oder wie man sonst sagen will. Dies scheint mir auch heute noch der größte Beitrag zur Weltkultur zu sein, den die italienischen Intellektuellen geleistet haben, eine kulturelle Eroberung, die nicht wieder verlorengehen darf.“ (17.08.1931)
Leider hat sich Gramsci geirrt bzw. ihn seine verständliche Hoffnung getrogen. Vielleicht konnte man vor einem knappen Jahrhundert auch nicht vorhersehen, dass sich die fortschrittlichen Teile der Menschheit sogar intellektuell zurückentwickeln, als zöge der Homo sapiens es vor, doch lieber auf das Niveau des Neandertalers zu sinken… Auch Lichtenberg lag im 18. Jahrhundert falsch: „Unsere Welt wird noch so fein werden, dass es so lächerlich sein wird, einen Gott zu glauben als heutzutage Gespenster.“ Das müsste man den so genannten Linken, vor allem in Deutschland, mal beibringen.
Judentum
Und tendiert nicht jede Gruppe oder Partei, jede Sekte oder Religion dahin, sich einen eigenen „Konformismus“ zu schaffen (nicht im Sinne einer Herde oder bloßer Mitläuferschaft? – Wichtig bei der Frage ist die Tatsache, dass die Juden erst 1848 aus dem Getto befreit wurden und fast zweitausend Jahre lang unfreiwillig, aufgrund äußeren Zwangs, im Getto und in jeder Weise getrennt von der europäischen Gesellschaft lebten. Von 1848 an verlief der Prozess der Assimilation im Westen so schnell und tiefgreifend, dass man meinen kann, nur die künstlich errichtete Trennung hätte ihre Assimilation in den verschiedenen Ländern verhindert, wenn nicht bis zur französischen Revolution das Christentum die einzige ›staatliche Kultur‹ gewesen wäre, die eben die Absonderung der unbekehrbaren Juden forderte (damals; heute nicht mehr, weil die Juden heute vom Judentum zum reinen und einfachen Deismus oder zum Atheismus übergehen). In jedem Fall ist darauf hinzuweisen, daß viele Charakterzüge, die als Rassenmerkmale angesehen wurden, in Wirklichkeit durch das in verschiedenen Ländern verschieden ausgeprägte Gettoleben verursacht wurden. Weshalb eben ein englischer Jude fast nichts mit einem galizischen Juden gemein hat. Gandhi repräsentiert heute offenbar die Hindu-Ideologie. Aber die Hindus haben die Dravida, die Ureinwohner Indiens, zu Parias gemacht. Sie waren ein kriegerisches Volk, und erst nach der mongolischen Invasion und der Eroberung durch die Engländer haben sie einen Menschen wie Gandhi hervorbringen können. Die Juden haben keinen Nationalstaat, keine Einheit der Sprache, der Kultur, des Wirtschaftslebens seit zwei Jahrtausenden. Wie könnte man also eine Aggressivität usw. bei ihnen finden? (05.10.1931)
Das ist also genau die Frage, die Isaac Deutscher nach der Shoa stellt – die „Frage jüdischer Identität jenseits von Religion und Nationalbewusstsein“.
Die einzige Weise, die Frage allgemein zu lösen, scheint mir darin zu liegen, dass der jüdischen Gemeinde das Recht auf kulturelle Autonomie (Sprache, Schule usw.) und auch auf nationale Autonomie zugestanden wird, falls es ihr in irgendeiner Weise gelänge, in einem bestimmten eigenen Land zu leben. Alles andere scheint mir Mystizismus von der schlechten Sorte zu sein, gut für die kleinen intellektuellen Juden des Zionismus, wie auch die Frage der ›Rasse‹, wenn sie in einem anderen als rein anthropologischen Sinne verstanden wird. Schon zu Christi Zeiten sprachen die Juden nicht mehr ihre Sprache, die zu einer liturgischen Sprache geworden war, sondern sie sprachen Aramäisch. (12.10.1931)
KI und die drei Gesetze der Magie, revisited

Domschatz Halberstadt: Rechts ein Armreliquiar des Apostels Jakobus des Älteren, Niedersachsen / Harzvorland, 1. Hälfe 14. Jh., Silber vergoldet, Edelsteine, Perlmutt, Glas, Kern aus Holz. Links: Niedersachsen / Harzvorland, um 1350/1360, Silber vergoldet, Bergkristall, Edelsteine, Email; Kern aus Holz
Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich dem gelehrten und des Feudalismus kundigen Publikum einen Bären bzw,. eine Reliquie aufbinden soll. Bei dem ein Jahrtausend alten Kram weiß doch niemand, ob das wirklich echt ist? Kann das die Künstliche Intelligenz nicht auch?
/describe des obigen hochgeladenen Fotos ergab two gold hands jewelry seated in front of the display, in the style of hieratic visionary, both hands have an opening with a relic inside, light bronze and dark beige, glass and ceramics, humanistic empathy, dau al set, human forms, raw metallicity –ar 3:4
Gegenprobe: Ohne das hochgeladene Bild kommt bei dem Prompt nur Blödsinn heraus. Eine Armreliquie ist für die KI ein schwerer Fall; so etwas ist vermutlich nicht vorgesehen.
Wir hatten das Thema ausführlich am 14.11.2021: „Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II)“. Ich schrieb über die der drei Gesetze der Magie bei Mauss: „Ähnliches erzeugt Ähnliches, Ähnliches wirkt auf Ähnliches, Konträres wirkt auf Konträres, und diese Formeln unterscheiden sich voneinander nur in der Anordnung ihrer Elemente. Im ersten Fall denkt man zunächst an das Fehlen eines Zustandes; im zweiten zunächst an die Anwesenheit eines Zustandes; im dritten vor allem an das Vorliegen eines Zustandes, der demjenigen entgegengesetzt ist, den man zu erzeugen wünscht. Im einen Fall denkt man an die Abwesenheit des Regens, den es mittels eines Symbols zu realisieren gilt; im anderen Fall denkt man an den strömenden Regen, dem es mit dem Mittel eines Symbols Einhalt zu gebieten gilt; auch im dritten Fall denkt man an den Regen, den man dadurch zu bekämpfen hat, daß man mittels eines Symbols sein Gegenteil hervorruft.“
Auch bei Amuletten, Talismanen und anderen Dingen, denen magische Kräfte zugeschrieben werden, sind diese drei Gesetze in Kraft. Vermutete Eigenschaften eines Objekt werden im kollektiven Denken auf andere Objekte übertragen, die entweder ein Teil des verehrten Ganzen sind, dessen man nicht mehr habhaft werden kann, oder dem ähnlich sind und/oder es berührt haben (wie in vielen Reliquiaren die angeblichen Nägel vom Kreuz Christi), oder das Gegenteil, mit dem man zum Beispiel etwas abwehren will.
Man darf also so etwas bei jedem (katholischen) Kirchenschatz erwarten. Falls jemand unvorbereitet darauf stößt, ist nur zu fragen: „Haben Sie auch Armreliquiare?“ Und schon gilt man vermutlich als Feudalismus-Experte.
Postscriptum: Der die Armreliquiare sehen will, begebe sich auf den virtuellen Rundgang durch den Halberstädter Dom und finde die Schatzkammer! Was die Halberstädter ihre Kirchenschätze online präsentieren, ist erste Sahne! Chapeau!
Postscriptum II: Man sehe sich an, wie die Stones nach vorn auf die Bühne gehen und was sie und das Publikum mit den Händen machen.
Bedeutende Faktoren, eng verbunden

male workers overseer holding a whip, in front of a farmhouse of the Roman Republic, villa rustica, several of male and female workers, amphoras, agricultural implements, fresco style, wall painting from Pompeji, environment landscape like Tuscany, natural lighting, –v 4 –ar 5:3 –s 750
„Slave“ und „slaves“ sind verboten, man kann sich denken, warum. Bescheuert ist es trotzdem. Bei Tieren versagt die Künstliche Intelligenz übrigens (noch) total. Bei mehreren Versuchen bekam ich zweiköpfige und fünfbeinige Fabelwesen, und der Unterschied zwischen Ochsen und Pferden schien der KI nicht bekannt zu sein. Der Stil der Bilder ist zwar korrekt, aber jeder vorchristliche Freskenmaler und jede Wandmalerei in Pompeji hätte sich mit Entsetzen abgewandt.
Frage: War die Ökonomie die Sklavenhaltergesellschaft im antiken Rom eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa?

acient roman farmhouse, villa rustica, style of Pompeji wall fresco, male and female workers::3, clothing of 2nd century BC, chicken, ducks, amphoras, agricultural implements, environment landscape like Tuscany::3, natural lighting, –v 4 –ar 5:3 –s 750 –s 750. Erst diese Version ergab ein einigermaßen akzeptables Ergebnis, obwohl die Römer die Hühner (?) nicht einfach so im Bild hätten herumschweben lassen. Vor 2000 Jahren war der künstlerische Homo sapiens um Klassen besser.
ChatGPT : Die Sklavenhaltergesellschaft im antiken Rom kann als ein bedeutender Faktor für die spätere Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa betrachtet werden. Die römische Wirtschaft war stark auf die Ausbeutung von Sklavenarbeit ausgerichtet, die für die Produktion von Waren und den Betrieb der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Dies führte zu einer Akkumulation von Reichtum und Kapital bei den römischen Eliten.
Die Antwort könnte auch aus dem Bertelsmann Volkslexikon stammen. Sie ist nicht wirklich falsch, beantwortet jedoch die Frage nicht. Es ist ohnehin schwer, die Frage überhaupt sinnvoll zu formulieren. „Hätte man die Sklavenhaltergesellschaft auch weglassen können?“ Wer ist dann „man“? Man erkennt, dass Künstliche Intelligenz maximal das vorhandene Wissen aufgreift und eventuell sogar sich widersprechende Theorien referiert, aber niemals selbst entscheidet bzw. eine Position einnimmt. Erst dann würde es mir unheimlich.

Hier verschwimmt mir der Stil zu sehr, als hätte die KI heimlich aus dem so genannten Frühmittelalter geklaut. Die Figuren könnten auch einen Heiligenschein tragen.
Die Nachwirkungen des römischen Sklavenhandels und der wirtschaftlichen Strukturen waren auch nach dem Untergang des Römischen Reiches spürbar. Insbesondere im Mittelalter und in der frühen Neuzeit entwickelten sich in Mitteleuropa zunehmend kapitalistische Wirtschaftsformen. Die Expansion des Handels, die Entwicklung von Manufakturen und später von Fabriken waren eng mit der Akkumulation von Kapital und der Ausbeutung von Arbeitskräften verbunden.
Auch das ist Gelaber. Es fehlt die Position, die von einigen Forschern mit durchaus starken Argumenten vertreten wird, es habe keinen „Untergang“ gegeben, und das sei ein irreführender Begriff.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa ein komplexer Prozess war, der von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wurde. Neben der römischen Sklavenhaltergesellschaft spielten auch andere Faktoren wie technologische Fortschritte, politische Rahmenbedingungen, soziale Veränderungen und kulturelle Einflüsse eine Rolle bei der Entstehung des Kapitalismus. Es wäre daher zu vereinfacht, die römische Sklavenhaltergesellschaft als die alleinige oder hauptsächliche Ursache für die Entwicklung des Kapitalismus in Mitteleuropa anzusehen.
„Vielzahl von Faktoren“ – das hätte ich auch schon vorher gewusst. Also müsst ihr weiterhin dieses Blog lesen. Die Fortsetzung meiner Feudalismus-Serie ist in Arbeit.
Zwei Sippen

Scrollen, scrollen und immer an die Wissenschaft denken!
Irgendwann vor langer, langer Zeit, als Studenten noch wissbegierig waren und lernen wollten, und zwar möglichst viel und alles, sagten sich zwei marxistisch denkende Altgermanistik-Dozenten, von denen beide, die mich damals für das Thema begeisterten, schon gestorben sind (einer von ihnen taucht im weltweiten Internet überhaupt nicht auf), man müsse da etwas anbieten, jenseits des normalen Angebots an Seminaren, weil das die besagten Studenten unterfordere, was in der Tat der Fall war. Und es begab sich, dass ein Oberseminar veranstaltet wurde für diese beiden Dozenten und ein halbes Dutzend Studenten (darunter nur eine Frau, aber eine ausnehmend attraktive, von der ich noch ein winziges Andenken irgendwo habe, was sie mir zugesteckt hatte – wir saßen in den Veranstaltungen nebeneinander).
Das Thema war gesetzt: Wir waren die Elite, besuchten notfalls auch Seminare von 20 bis 22 Uhr (in so einem – freiwilligen! – Seminar lernte ich Ludwig Feuerbach kennen und lieben), und hochmotiviert im Superlativ. Also musste es das schwierigste und anspruchsvollste altgermanistische Thema sein, das es gibt – den Parzival von Wolfram von Eschenbach, dergestalt, dass wir das Epos, welchselbiges die bürgerliche Literaturwissenschaft rein überhaupt nicht in den Griff bekommen hatte, marxistisch analysieren wollten, was wir schon bei anderen Werken – wie dem Herzog Ernst, dem Rolandslied und vor allem dem Helmbrecht – unseres Wissen nach erfolgreich getan hatten, mit enormem Erkenntnisgewinn, und was uns in der Meinung bestärkte, die bisherige Forschung sei in Gänze dem Inhalt nicht gerecht geworden, sondern – wir vermaßen uns das zu behaupten! – irre vollständig und sei komplett auf dem Holzweg.
Die Notiz – teilweise mit einer Schreibmaschine geschrieben! – ist mir von diesem Seminar geblieben: Wir mussten die tribalistischen Verwandtschaftsbeziehungen auseinanderdröseln, um einen Überblick zu bekommen, wer warum auftauchte und in welcher Funktion. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Wolfram das alles im Kopf hatte und das Epos natürlich mündlich vorgetragen wurde.
Das würde alles zu weit führen. Mittelhochdeutsche Literatur darf man nicht wie heutige Romane rezipieren. Feudalismus, wie die Stammleser schon wissen, unterscheidet sich fundamental vom Kapitalismus, eine orale und magische Gesellschaft, die sich komplett anders konstituiert und auch darstellt. Die Handlung ist weitaus weniger wichtig als in moderner Literatur. Sie ist eher mit der „Handlung“ einer katholischen Messe vergleichbar, die man nicht verstehen würde, wenn man nur fragte, warum der Kerl wo und wie schnell am Altar herumlaufe.
Aber wir geraten ins Plaudern. Das Stammpublikum weiß, wie das alles endete.
Zwischenergebnis, und alles zeigt in den fernen Osten
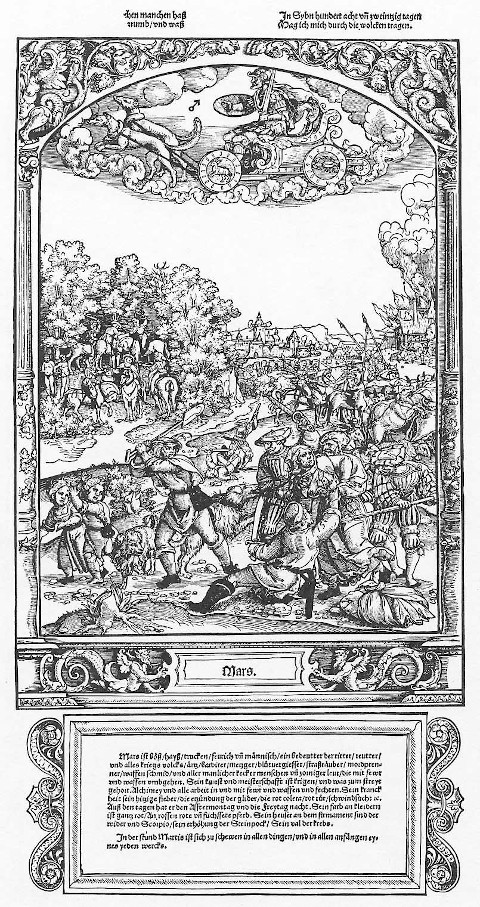
Georg Pencz (1500-1550): Mars
Ich habe natürlich meine Aufstellung so gehalten, daß ich im umgekehrten Fall auch Recht habe. (Karl Marx).
Das Publikum verlangte nach einer Zwischenbilanz der Serie über den Feudalismus. Das ist verständlich, da man nicht verlangen kann, dass jemand, der davon zum ersten Mal hört, alle Artikel zum Thema rezipiert, zumal das Tage dauern würde (es müssen natürlich auch die Fantastilliarsen Links alle ausnahmlos aufgerufen werden!). Vor sieben Jahren startete ich mit der harmlosen Frage: Wie beschreibt man eine Gesellschaft hinreichend – und mit welchen Begriffen? Nichts ist „natürlich“, obwohl die Herrschenden aller Zeiten ausnahmslos das Gegenteil behaupteten. Darum ging es in einer Art
1. Prolog: „Reaktionäre Schichttorte“ (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse.
2. Was ist „Feudalismus“? Die Frage ist heikel, denn behauptete man eine Art Gesetzmäßigkeit der Evolution von einer Gesellschaftsform zur anderen oder gar eine bestimmte Reihenfolge, dürfen „bürgerliche“ Historiker nicht weiter forschen, ohne die Frage beantworten zu müssen: Gibt es gar eine Gesellschaftsform jenseits des Kapitalismus? Und wie sähe die aus?
In „Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus“ (Fotos: Quedlinburg) fasste ich diverse und sich widersprechende Analysen zusammen. Es gibt seit dem Zusammenbruch des so genannten „realen Sozialismus“ keine deutsche marxistische Mediävistik mehr. Es sieht aber so aus, als hätte der DDR-Historiker Bernd Töpfer recht gehabt, der damals behauptete, der Feudalismus sei die am weitesten entwickelte Stufe der vorkapitalistischen Gesellschaften; er könne sich sowohl aus einer „zersetzenden“ Urgesellschaft [also aus einer tribalistischen Gesellschaft, B.S.] wie auf dem Hintergrund der asiatischen Produktionsweise oder einer Sklavenhalterordnung entwickeln. Genau das sagt heute – mit anderen Begriffen – die „bürgerliche“ Geschichtswissenschaft, wie der hier oft zitierte Michael Mitterauer in seinem hervorragenden Buch Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs.
3. Wie sieht eine orale Gesellschaft wieder Feudalismus aus und welche Funktion haben die Objekte, die Herrschaft darstellen, insbesondere Reliquien? Das war die Ausgangsfrage in „Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften“ (Quedlinburger Domschatz I) und in „Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019)“ – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II).
4. Danach kommt ein Einschub: „Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019)“ – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III).
Wenn man den Feudalismus in Mittel- und Nordwesteuropa – der in der Weltgeschichte zuerst den Kapitalismus hervorgebracht hat – beschreibt und definiert, muss man erklären, warum die Entwicklung in anderen Regionen ganz anders verlief. Trotz der Jahrhunderte langen gemeinsamen Geschichte war der „polnische“ Feudalismus anders.
5. Ein weiterer Einschub: „Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019)“ – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg).
6. In „- Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges“ (15.06.2019) definiere ich „Feudalismus“ als analytische Kategorie und versuche zusammenzufassen, was zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert im Klassenverhältnis zwischen herrrschendem Feudaladel und den Bauern geschah (Stichwort: Leibeigenschaft).

Georg Pencz (1500-1550): Triumph des Todes, Kupferstich
7. „Yasuke, Daimos und Samurai [I]“ (24.07.2019) sowie „Yasuke, Daimos und Samurai [II]“ (03.05.2020) thematisieren den Feudalismus in Japan, der – laut Marx – noch „typischer“ für die analytische Kategorie „Feudalismus“ ist als die mitteleuropäische Version, dem aber keine Sklavenhaltergesellschaft voraufging. Wir tragen hier also alle marxistischen Theorien zu Grabe (die stalinistischen sind keine Wissenschaft, müssen also nicht gesondert geschreddert werden), die behaupten, die Menschheitsgeschichte sei durch die „Formationen“ Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalimus und Sozialismus (und irgendwo dazwischen „Asiatische Produktionsweise“) zwangläufig bestimmt (falls jemand nach einen Zwischenergebnis fragte).
8. „Agrarisch und revolutionär (I)“ (21.02.2021) widmet sich der zentralen Frage, warum es eine agrarische Revolution im Feudalimus gab und nicht etwa im Römischen Weltreich und warum andere agrarische Revolutionen zur fast gleichen Zeit – in Arabien und China – zu einem anderen Ergebnis führten bzw. zu keinem, das dem Kapitalismus näher kam.
9. Die Einschübe „Trierer Apokalypse und der blassrose Satan“ (17.03.2021) und „Energie, Masse und Kraft“ (04.04.2021) widmen sich der Technikgeschichte der agrarischen Revolution in Nordwesteuropa.
10. „Agrarisch und revolutionär II „(15.05.2021) setzt die Diskussion von „Agrarisch und revolutionär (I)“ fort, vor allem im Vergleich mit China.
11. Die ersten vier Teile der Serie über den Essener Domschatz („Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri“ (Essener Domschatz I) (28.10.2021), „Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021), „Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise“ (Essener Domschatz III) (27.11.2021) und „Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer „(Essener Domschatz IV) (17.12.2021) erörtern noch einmal die These von Punkt 3: Objekte sind dingliche bzw. verdinglichte Zeichen der sozialen Hierarchien und der Rituale in oralen Gesellschaften wie dem Feudalismus aka Früh- und Hochmittelalter (also die Zeitspanne zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert).
Der 5. Teil „Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation“ (Essener Domschatz V) (23.12.21) beschäftigt sich wieder mit der Frage, warum sich der Kapitalismus bzw. dessen ökonomischen Voraussetzungen zuerst in Westeuropa entwickelt haben.
Ich schrieb: Jetzt erscheint die von mir schon fast verworfene Frage bzw. These marxistischer Theoretiker in einem anderen, sogar vorteilhafteren Licht, ob der Feudalismus sich nur dann zum Kapitalismus entwickele, wenn er auf der Sklavenhaltergesellschaft fuße – oder ob es theoretisch auch ohne ginge. Da kein Paralleluniversum existiert, in dem wir das testen könnten, ist die Antwort einfach: Die These der angeblich zwangsläufig aufeinanderfolgenden Gesellschaftsformationen sagt nur etwas über die Geschwindigkeit aus, mit der letztlich der Kapitalismus in England zuerst entstand. Da die kapitalistischen Staaten Mitteleuropas in kurzer Zeit fast die ganze Welt unterjochten und der ihre Ökonomie aufzwangen (wie auch die Römer den unterworfenen Völkern), bleibt die Frage rein hypothetisch, was etwa aus China geworden wäre, wenn es keine Weltkriege und eine japanische Okkupation, keinen Langen Marsch und keine Revolution gegeben hätte.
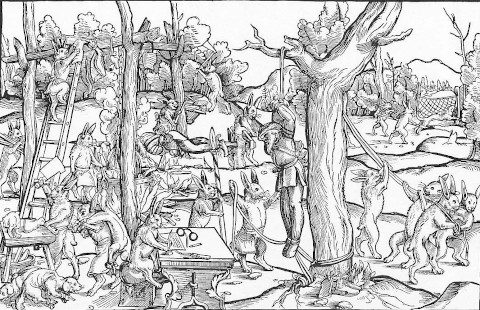
Georg Pencz (1500-1550): Hasen fangen die Jäger
These (wieder ein Zwischenergebnis): Die antike Sklavenhaltergesellschaft trieb als Basis die Ökonomie im Frühfeudalismus antrieb. „Man kann nicht behaupten, dass Latifundien und das Kolonat die conditio sine qua non waren, aber wenn sie als Grundlage existierten, beschleunigten sie offenbar die Agrarrevolution. Und das war nur im Frankenreich und in England so. In anderen Regionen des ehemalige römischen Reiches stimmte die Ökologie nicht.“
12. „Jenseits des Oxus (09.01.2022) erweitert die Fragen auf die Regionen zwischen Europa und China. Fazit (noch ein Zwischenergebnis): „In China hat sich eine zentralistische „Verwaltung“, auf der der ganze Staatsapparat und auch die Produktion fußt, wesentlich früher entwickelt als in Europa. In Indien war das nicht so. In Frankreich und in Preußen gab es das erst vergleichbar erst im späten 16. Jahrhundert, also zur Zeit der Manufakturen, den Vorläufern der Fabriken.“
13. in „- Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)“ wird die gesamte Diskussion zusammenfasst, inklusive der „Asiatischen Produktionweise“. Die Fragen:
a) Der europäische Feudalismus war offenbar ein Sonderweg. In anderen Regionen der Welt gab es feudale Verhältnisse auch, etwa in Japan, aber der Kapitalismus entwickelte sich dort viel langsamer, wenn überhaupt.
b) Braucht es eine Sklavenhaltergesellschaft vor dem Feudalismus – oder ist das Römische Weltreich ebenfalls ein zu vernachlässigender Sonderfall?
c) China ist heute die einzige Gesellschaft, in der sich Ansätze entwickeln, die zu nachkapitalistischen Produktionsverhältnissen führen könnten. Dort gab es aber keine Sklavenhaltergesellschaft. Könnte es sein, dass dieser Weg letztlich derjenige ist, der den Kapitalismus zuerst überwinden wird?
These: Es gibt nur ein „logischen“ Schema, wie die Menschheit sich von einer klassenlosen „Urgesellschaft“ bis zur Klassengesellschaft im Kapitalismus entwickelte, aber mitnichten eine historische Abfolge. Die Frage, ob es für den Kapitalismus vor dem Feudalismus einer Sklavenhaltergesellschaft bedürfe oder nicht, ist also falsch gestellt und unsinnig.
14. „Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)“ beschäftigt sich mit dem Übergang von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus, also die fließende Grenze zwischen dem Kolonat der spätrömischen Antike und der frühfeudalen Villikation (ab dem 7. Jh.).
15. Dreiteiliger Einschub: „Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I)“ (18.07.2022). „Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung „(Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022) und der dritte Teil – der bald kommt – diskutiert die obigen Fragen aus weltgeschichtlicher Perspektive: Wie entwickelte sich die Ökonomie in Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien im Vergleich zu Europa (also von der Urgesellschaft bis zum Feudalismus)?
Ich bin noch lange nicht fertig. Aber alles zeigt in Richtung China….
Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II)

Inca Roca, erster Herrscher der 2. Dynastie von Hanan Qusqu (Ober-Cusco), Gründer der Inka-Schulen Yachaywasi (Häuser des Wissens). Gemälde von Amilcar Salomón Zorilla (Postkarte 1984).
Fortsetzung von Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) von Herrmann Parzinger
Wir müssen uns kurz mit negativer Dialektik der Subjunktion befassen, also eine Art Kontrollversuch starten, der uns erläutert, warum der kürzeste Weg zum Kapitalismus zu einer Hochkultur, also einer Zivilisation, die nicht mehr tribalistisch organisiert ist oder aus bloßer Subsistenzwirtschaft besteht, der des fruchtbaren Halbmonds und Ägypten war. Wir argumentieren also negativ: Warum blieben ganz Amerika und Afrika und Ozeanien noch im Stadium der Bronzezeit, während in Europa schon das Zeitalter der ursprünglichen Akkumulation anbrach, also des frühen Kapitalismus, mit dementsprechender ökonomischer und waffentechnischer Überlegenheit? (Asien kriegen wir im dritten Teil.) Was sind also die Variablen und die Konstanten?
Dumme Frage: Hätte eine römische Legion die Inka-Armee plattgemacht? Oder hätten die Spartaner gegen die Muisca gewonnen? Ja, weil die Hochkulturen Süd- und Mittelamerikas zwar Gold und Silber in Hülle und Fülle besaßen, aber keine Eisenverhüttung kannten, keine Pferde und das Rad nicht zum Transport genutzt wurde. Auch Afrika – etwa die Nok-Kultur – war hier viel „langsamer“.
Laut Parzinger fand man erste Spuren menschlicher Siedlungen in Südamerika schon 12.000 Jahre v. Chr., also im Pleistozän. Sechs Jahrtausende später bauten die Menschen der Las-Vegas-Kultur“ schon Mais und Kürbisse an. (Leider kannte ich damals die Liebenden von Sumpa nicht, sonst hätte ich heute ein Foto von ihnen.)

Künstlich herbeigeführte Schädeldeformationen aus der Paracas-Kultur (900 bis 200 v. Chr.) bei Ica in Peru (Marcin Tlustochowicz/Wikipedia)
Die Valdivia-Kultur in Ecuador existierte zeitgleich mit dem alten Ägypten; man hat laut Parzinger auch Monumentalbauten errichtet (die ich aber im Internet nicht finden konnte). Spannend ist, dass heute sogar ein Kontakt der Ur-Ecuadorianer mit Japan nicht mehr unwahrscheinlich ist.
Als sich in Südamerika die ersten Chiefdoms bildeten, etwa im kolumbianischen San Augustin mit seinen kolossalen Steinfiguren, sind wir in Zentraleuropa schon bei den Domschätzen angelangt, die ich der Leserschaft zum Erbrechen vorgeführt habe, Kaifeng in China hatte schon eine halbe Million Einwohner, Cordoba, Kairo und Bagdad waren Weltstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die „Großstadt“ Chavín de Huántar in Peru hatte ihre Blütezeit, als die Römer schon halb Europa eroberten.
Parzinger spricht in Südamerika von vielen „retardierenden Bedingungen“, vor allem ökologischer Natur, zum Beispiel bei der Chinchorro-Kultur, deren Mumien 2000 Jahre älter sind als die der Ägypter:
Der trotz allem unwirtliche Lebensraum beeinträchtigte auch ihren allgemeinen Gesundheitszustand, wie paläopathologische Untersuchen an den Skeletten erbracht haben. Der permanente kalte Wind führte allenthalben zu Entzündungen des Ohrkanals. Hinzu kam die hochinfektiöse sogenannten Chagas-Krankheit – eine ebenso heimtückische wie unheilbar-chronisch verlaufende Infektionskrankheit, die den Betroffenen oft ein jahrzehntelanges Leiden beschert-, während der Verzehr von rohem Fisch vielfach zur Infektion mit Bandwürmern führte. Osteoporose war weitverbreitet, und die meisten Männer wie Frauen litten aus unterschiedlichen Gründen an manifesten Rückenproblemen. Viele Infektionen zogen sich die Träger der Chinchorro-Kultur aber ganz offensichtlich auch bei der Mumifizierung ihrer Verstorbenen zu, wenn sie mit infizierten Körpern hantierten und dabei keine entsprechende Vorsicht walten ließen.
Das allein beantwortet aber nicht die Frage nach den Variablen und Konstanten. Zum Beispiel gab es – im Unterschied zu Vorderasien, Afrika und Europa – in Amerika keine Reittiere und auch keine, die schwere Lasten ziehen können. Lamas finden Menschen auf ihrem Rücken unsympathisch und wollen auch partout nichts ziehen; Kamel und Dromedare lassen es hingegen mit sich machen. Das Pferd als Ackergaul ist eine „Erfindung“ des frühen Feudalismus in Nordwesteuropa. Rinder gab es in China schon vor zehn Jahrtausenden, und Pferde mindestens so lange wie im Vorderen Orient. Aber für den Reis- und Hirseanbau, die zentralen Pfeiler der chinesischen Landwirtschaft, braucht man Rinder und Pferde kaum als Nutztiere.
Parzinger schreibt, dass vor allem die ökologische Kontinuität im Fruchtbaren Halbmond ein Vorteil für Ackerbauern war; in Afrika hingegen wechselten die klimatischen Bedingungen oft (wenn man in Jahrtausenden denkt). Indien, China und auch das alte Mesopotamien und Ägypten haben mit den Hochkulturen Mittel- und Südamerikas gemein, dass die herrschende Klasse Teile der Arbeit kollektiv organisieren musste, vor allem die Regulierung des Wassers für die Landwirtschaft. Die Inka kannten überhaupt keinen Privatbesitz an Grund und Boden. Deren Klassenherrschaft war immerhin so effektiv, dass die Konquistadoren sie fast bruchlos übernehmen konnten und nur das Personal austauschten. Allerdings wurden alle „alten“ kollektiven Formen wie etwa des eher „genossenschaftlichen“ Ayllu, marginalisiert.
Man könnte herumspekulieren, dass die kollektive Organisation der Arbeit – auch die so genannte „Asiatische Produktionsweise“ (hier auch „alt-amerikanische“) – für die Entwicklung zum Feudalismus eher hinderlich ist, was die „Geschwindigkeit“ angeht. Der Kapitalismus setzt voraus, dass es Massen von Menschen gibt, die nichts mehr zu verkaufen haben als die Arbeitskraft, also den „freien Warenproduzenten“. Das setzt aber den an die Scholle und an den Feudalherrn gebundenen Bauern voraus: Wenn der von beiden „erlöst“ wird, ist er Proletarier oder Landstreicher oder tot. Der Feudalismus setzt mitnichten eine Sklavenhaltergesellschaft voraus. Die – die mitteleuropäische Antike – ist eher ein historischer Sonderfall, begünstigt aber den Ruin der kleinen Bauern, der letztlich im Kolonat endet. Von dort ist es nicht mehr weit – sogar ein fließender Übergang – zur Villikation und zum Feudalismus.
Post Scriptum: Ich werde den Parzinger in die allgemeine Reihe über den Feudalismus aufnehmen. Der dritte Teil über Asien folgt alsbald.

„Unku“ (Tunika oder Poncho) aus gewebter Baumwolle, ca. 1400-1600 (Postkarte 1984)
__________________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Brutal but important lesson
Workingclasshistory auf Instagram:
On this day, 14 June 1381, during the peasants’ revolt in England, Wat Tyler’s rebel army of some 50,000 to 100,000 people captured London Bridge and the Tower of London. There they killed the chancellor, Archbishop Simon of Sudbury, and the treasurer, Sir Robert Hales.
The rebellion had broken out in May in protest at the imposition of a poll tax on everyone aged fifteen and over, which exacerbated the economic hardship of workers and the poor. People were also enraged by the brutality of tax inspectors, who measured people’s pubic hair to determine their age, which was seen as state-sanctioned sexual assault, particularly in the case of girls and women. The rebellion soon developed into a deep and sophisticated social movement demanding radical changes to feudal society and peaked with the taking of the Tower.
On June 15, Wat Tyler attended a parley with the king Richard II, where he was murdered. Realising his weak position, Richard promised the rebels that he would implement many of their demands, including the abolition of the tax, and even the abolition of forced labor and serfdom, but, while the poll tax was ended, once the rebels had dispersed and returned home, they were no longer a threat, so Richard reneged on all of his other pledges and hanged 1,500 of them. It was a brutal but important lesson not to trust the promises of the powerful.
Zum Vergleich muss man den oberflächlichen Quatsch im deutschen Wikipedia lesen – als würde Aschwin von Cramm über den Tod Thomas Münzers schreiben.
Missing Link oder: Franziska und kleine Könige
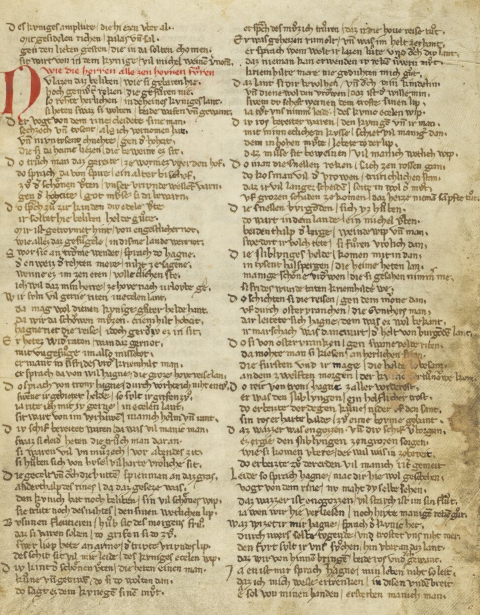
Das Nibelungenlied und die Klage (Leithandschrift A): „Wie die herren alle zen Hevnen [Hunnen] fvren“. Ein historischer Kern oder Anknüpfungspunkt der Sage ist die Zerschlagung des damals von Gundahar [by the way: interessante Vornamen für männliche Neugeborene!] beherrschten Burgunderreiches im Raum von Worms um 436 durch den römischen Konsul und Magister militum (Heermeister) Aëtius mit Hilfe hunnischer Hilfstruppen.
Ich sage nur: Audofleda, Amalasuntha, Dietrich von Bern, Childerich, Aegidius, Fredegar sowie der Liber Historiae Francorum (wer fließend Latein lesen kann). Habe ich jemanden vergessen? Eventuell Syagrius?
Dann holen wir tief Luft und beginnen mit dem Schlusskapitel von Thomas Fischers Gladius – Roms Legionen in Germanien:
Die Auflösung des weströmischen Reiches außerhalb Italiens war ein längerer Prozess: Weite Teile gerieten bereits gegen Ende des 5. ]h.s de facto unter die Herrschaft von Germanenstämmen, etwa den Vandalen, Franken, Burgundern und Westgoten. Sie alle waren in ein Machtvakuum vorgestoßen, das der Zerfall der römischen Zentralregierung hinterlassen hatte. Aber auch die Macht der neuen Herren war nıcht immer unangefochten: Ostgoten, Vandalen, Franken, Burgunder und Westgoten stellten in ihren Herrschaftsgebieten nur eine Minderheit dar, die über die große Anzahl von römischen Untertanen römisch-katholischen Bekenntnisses herrschte. Da aber die germanische Oberschicht zumeist nicht dem römisch-katholischen Glauben anhing, sondern der arianischen Glaubensrichtung, verschärfte dies die Spannungen zwischen Herrschern und Beherrschten. Nur im Frankenreich, das sich dann ım Verlauf der weiteren Entwicklung als Großmacht und Haupterbe des römischen Reiches im Westen* durchsetzen konnte, fand sich für dieses schwerwiegende Problem eine Lösung…
Minderheiten, die über Mehrheiten herrschen bzw. deren herrschende Klasse ersetzen, haben wir oft in der Geschichte, zum Beispiel die mongolische Yuan-Dynastie in China oder die Spanier in Lateinamerika. Es kömmt aber auf die Ökonomie an.
Mit Childerich haben wir ein erstes politisches Missing Link zwischen Sklavenhaltergesellschaft und Feudalismus: Ein fränkischer Warlord, also ein Germane, der sich (lateinisch!) Rex nannte und dessen Truppen als römischer Verbündete (foederati) in Gallien dienten. Die Historiker sind bei der Frage, was dieser Franke eigentlich exakt war, heillos zerstritten („ist aber nicht immer klar, ob Childerich als römischer Befehlshaber oder als fränkischer Anführer bzw. König agierte“). Childerich verwaltete in der Endphase des römischen Galliens die römischen Provinz Belgica Secunda aka Gallia Belgica, auch als militärischer Befehlshaber (dux).

Fingerring bzw. Siegelring (anulus) des merowingischen, fränkischen Königs Childerich (Hilderich) – Beschriftung: (Sigillum) CHILDERICI REGIS. Childerich hat auf dem „Portrait“ einen geschorenen Bart und, wie bei fränkischen Königen üblich, langes Haar trug (rex crinitus).
Wir wiederholen:
| Wir müssen hier ein berühmtes Zitat aus dem Vorwort von „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ von Marx abklopfen, ob es mit der Realität übereinstimmt: |
| „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.“ |
| „Soziale Revolution“ meint offenbar nicht das Klischee, dass Männer in langen Wintermäntel und mit Gewehren Paläste stürmen, sondern dass die Eigentums- und Produktionsformen radikal umgewälzt werden. Insofern ist die „Spätantike“ durchaus eine solche Epoche. Sehr interessant ist, dass die aktuelle bürgerliche Forschung das ähnlich sieht und von einer Transformation spricht. |
| Joseph Tainter scheint der Marxschen These sogar sehr nahe zu kommen. Sein Hauptwerk Collapse of Complex Societies definiert diese „soziale Revolution“ als „Kollaps“: a rapid, significant loss of an established level of sociopolitical complexity, also genau das, war mit dem Römischen Weltreich geschah. |
Liebe Kinder, als Hausarbeit lernt ihr bitte folgende fränkischen Namen auswendig: Childerich („Missing Link“), Chlodwig (der zum Christentum konvertierte, also das oben genannte angebliche „schwerwiegende Problem“ löste), Karl Martell (der islamfeindlich war – Frau Chebli, bitte übernehmen!). Überlegt euch ein, zwei Sätze dazu. Mehr muss man heute über die vier Jahrhunderte vor Karl dem Großen nicht wissen. Außerdem gibt es ohnehin kaum belastbare Quellen.

Fränkische Wurfaxt Franziska (Stiel neuzeitlich), 6. Jahrhundert, Grabfund 1935, Museum Grünstadt [Vorsicht! Bei der Website braucht man eine Sonnenbrille!]. Credits: Altera levatur / Wikipedia
Wir reden also, was die Ökonomie betrifft, über die fließende Grenze zwischen dem Kolonat der spätrömischen Antike und der frühfeudalen Villikation (ab dem 7. Jh.).
Wir haben hier eine Sythese zwischen der herrschenden Klasse der westgermanischen Kriegergruppen und deren Warlords und dem romanisierten Volk, das für diese arbeitete, nachdem die überregionale Verwaltung des weströmischen Reiches weggebrochen war. Ob die Goten, Vandalen, Burgunder, Franken, Langobarden oder Sachsen die neuen Herrscher gewesen wären, bleibt letzlich eine Frage des historischen Zufalls, wer wen in welcher Schlacht entscheidend massakrierte. Es hätte an der Ökonomie und deren langfristigen Entwicklungstendenzen nichts geändert.
* Im Süden waren die „Erben“ die Umayyaden, und im Osten natürlich das tausendjährige (!) byzantinische Reich. Aber diesen beiden „Erben“ bzw. deren Regionen gelang der Sprung zum Kapitalismus nicht so schnell wie in Nordwesteuropa.
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Feucht-schwüle nibelungische Killer-Hasen

Während meine Gelenke quietschten und die Muskeln zappelten, sprach ich mit meiner bezaubernden, aber sehr jungen Physiotherapeutin über dieses und jenes. Als sie mich fragte, was ich studiert habe und ich „Altgermanistik“ anwortete, merkte ich an ihrem Gesichtsausdruck, dass ich auch hätte hieroglyphische Assyriologie antworten können, obzwar sie „interessant“ murmelte. Das, sehr geehrte alte weiße Männer mit feucht-schwülen Träumen, ist kein Interesse, sondern professionelle Empathie, bedeutet also rein gar nichts. Ich reagierte spontan und bot ihr an, am nächsten Tag – während meine neue Hüfte die ersten Salsa-ähnlichen Turns machte – das Nibelungenlied zu rezitieren, selbstredend auf Mittelhochdeutsch. Das fand sie dann doch lustig.
Später fiel mir ein, dass eine interessantere Anmache, fände dieses Gespräch in einer lauschigen Bar statt, gewesen wäre, etwas über Killerhasen in feudalen Handschriften zu erzählen. Darüber weiß ich aber nicht viel – ich müsste also, nachdem die Aufmerksamkeit geweckt, doch auf dem kürzestem Weg zurück zum Nibelungenlied, über das ich vermutlich stundenlang referieren könnte, ohne einmal im Internet nachschauen zu müssen oder auf meinem Blog.
Ich stelle mir also die Aufgabe, rein hypothetisch natürlich, wie so etwas aussehen könnte, umrahmt von schummerigem Licht, guten Getränken und einem Mädel gegenüber, dass schon fest entschlossen ist, wenn die ersten zwei Minuten langweilig werden, sich alsbald dem nächstbesten veganen Hipster mit Waschbrettbauch an denselbigen oder den Hals zu werfen.
Wir wiederholen heimlich, um für alle Fragen gewappnet zu sein: Der zentrale (Klassen-)Konflikt im Nibelungenlied thematisiert genau das Problem: Während die eine Fraktion darauf beharrt, dass die Kriegerkaste hierarchisch geordnet ist – mit dementsprechenden eindeutigen Rechten und Pflichten, aber auch dem Risiko, dass jeder jedem baldmöglichst den Schädel einschlägt, um sozial aufzusteigen, verweigert die andere das, sondern schmuggelt unverbindliche Begriffe wie friund ein, die das Lehnswesen aushebeln, weil niemand weiß oder nachvollziehen kann, wer bei „Freunden“ das Sagen hat. Das ist das Todesurteil für eine orale Gesellschaft. Das Nibelungenlied – eigentlich eine Art Propagandaschrift der Ministerialen, die nicht mehr Vasallen waren, lässt die „altertümliche“ Fraktion sich gegenseitig abschlachten, bis niemand mehr übrig bleibt, was die Rezipienten sicher richtig verstanden haben. Das wäre so, als stünde am Schluss eines „Tatorts“ auch der Tod der Kommissare und aller Statisten.
Das Nibelungenlied ist aber trotzdem „altertümelnd“, weil alle vergleichbaren Epen, die im 13. Jahrhundert entstanden, etwa der Parzival – für mich das feudale Epos schlechthin – zwar Hauen und Stechen exzessiv schildern, aber die Protagonisten fast immer überleben lassen. So grimmig und gruselig (wenn man den stabgereimten Original-Text sich vorliest) wie das Nibelungenlied endet nur noch das rätselhafte Hildebrandslied, das aber rund 300 Jahre älter ist.

14th century, Ms. 121, fol. 23r, Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, France. Detail. (CC BY-NC 3.0)
So wird das natürlich nichts. Die Dame hängt schon auf dem Schoß des Hipsters. Also anders.
„Mitteldeutsch? Braucht man das oder kann das weg?“
„Wenn man sich für Literatur interessiert, kann man das nutzen, um zu kapieren, dass es immer nur um das Eine geht…“
„Um Sex? Bist du nicht ein bisschen zu direkt?“
„Das Eine meint meint hier: Klassen, die sich bekämpfen, nutzen die Geschichten (besser vielleicht wie das Original: alte maeren), die vorgesungen wurden, um sich gegenseitig die Welt zu erklären – ungefähr wie Linton Kwesi Johnson.“
„Der spielt doch Reggae?“ (Dame denkt: Kennt der Kerl sich etwa mit Popkultur aus?)
„Der Musikstil ist egal, aber Songs wie Forces of Victory erzählen mehr als das, was in den Medien vorkommt. Oral history und so. So ist es vor einem Jahrtausend auch, nur ein bisschen komplizierter.“
„Soso.“ (Dame nickt und bleibt sitzen.)
„Die Literatur um 1200 ist nur für die Herrschenden bestimmt, das Volk taucht nicht auf und hört auch nichts davon. Lesen konnten sowieso nur Mönche. Kompliziert, weil die Thesen kodiert sind und wir Texte heute sowieso anders rezipieren. Hegel hat gesagt, dass feudale Epen ungefähr wie eine katholische Messe seien. Hegel turnt garantiert ab.
„Kodiert? Ich bin keine Mathematerikerin!“
„Kostümiert ist besser. Denk an Fifty Shades of Grey – zu direkt Games of Thrones: Das ist eigentlich eine Soap Opera, nur mit komischen Klamotten und Drachen. (Eventuell ist der Zusatz nötig: Den Quatsch habe ich nie gesehen.) Im Nibelungenlied kostümieren sich Ministeriale, eine Klasse, damals recht „modern „war, als frühmittelalterliche Schlagetots. Deren Zeit war aber schon vorbei. Das ist extrem verkürzt – nein, das weckt falsche Assoziationen. Das würde jetzt langweilig werden, wenn wir ins Detail gingen, warum sie das tun und wie…“
„Kommt im Nibelungenlied auch Sex vor?“
„Ziemmlich drastisch sogar – Brünhilde denkt, sie fickte mit ihrem Ehemann Gunther, in Wahrheit ist es aber Siegfried – so eine Art indirekter Dreier. Willst du wirklich die Details?“
Dame lächelt und bestellt noch ein Getränk.

A killer rabbit in the medieval manuscript Bréviaire de Renaud de Bar (1302-1304). Ms 107, fol.-89r-89r. Source: Bibliothèque de Verdun/ CC BY-NC 3.0
Jemeljan Pugatschow
Man liest wieder russische Literatur, hier von Alexander Puschkin: Geschichte des Pugatschew’schen Aufruhrs. Gibt es aber auch digital. Jemeljan Iwanowitsch Pugatschow war sozusagen eine Art Thomas Müntzer Russlands, nur rund 200 Jahre später.
Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI)
Auf drängenden Wunsch des Publikums wird die beliebte Serie jetzt fortgesetzt.
| Kreuznagelreliqiar, um 1040/49, im 14. Jahrhundert modifiziert. Man weiß nicht exakt, wie das Original aussah, ob etwa der Nagel frei einsehbar war. Der Kristall lässt sich öffnen, dieser Mechanismus und der Rahmen stammen aus der Gotik. Die Motive der Emails „zitieren“ die des Theophanu-Evangeliars [hatte ich hier noch nicht gepostet]. Die Stifterin lässt sich nur indirekt beweisen. |
| Klaus Gereon Beuckers schreibt in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein: „Tafelförmige Reliquiare insbesondere für Christus-Reliquien sind spätestens seit dem 10. Jahrhundert aus Byzanz gut überliefert. (…) Eine vergleichbare Disposition weist der so genannte Talisman Karls des Großen im Reimser Kathedralschatz auf [Palais du Tau]. Auch andere Werke des Essener Umkreises wie das Borghorster Kreuz [das 2013 gestohlen und für 100.000 Euro zurückgekauft wurde] oder das Gandersheimer Heilig-Blut-Reliquiar präsentieren um die Mitte des 11. Jahrhunderts Reliquien in Kristallgefäßen, die in den Rahmen einer Goldschmiedearbeit eingebunden waren. Dies war in der Zeit neu und greift Entwicklungen des 13. Jahrhunderts vor, in denen – ebenfalls in Rezeption byzantinischer Arbeiten – dann auch Körperreliquien sichtbar präsentiert wurden. Das Essener Nagelreliquiar nimmt unter den ottonischen bzw. frühsalischen Reliquiaren eine hervorragende Position ein und ist auch wegen seiner Tafelform innerhalb des erhaltenen Denkmälerbestandes einzigartig.“ |
Fragen über Fragen
Nachdem wir im letzten Beitrag dieser Serie (Jenseit des Oxus) überall zwischen der Levante, Afghanistan, Indien und China der letzten 3000 Jahre herumge(schw)irrt sind, hier noch einmal die Fragen:
a) Der europäische Feudalismus war offenbar ein Sonderweg. In anderen Regionen der Welt gab es feudale Verhältnisse auch, etwa in Japan, aber der Kapitalismus entwickelte sich dort viel langsamer, wenn überhaupt.
b) Braucht es eine Sklavenhaltergesellschaft vor dem Feudalismus – oder ist das Römische Weltreich ebenfalls ein zu vernachlässigender Sonderfall?
c) China ist heute die einzige Gesellschaft, in der sich Ansätze entwickeln, die zu nachkapitalistischen Produktionsverhältnissen führen könnten. Dort gab es aber keine Sklavenhaltergesellschaft. Könnte es sein, dass dieser Weg letztlich derjenige ist, der den Kapitalismus zuerst überwinden wird?
„Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Die Andeutungen auf Höhres in den untergeordneten Tierarten können dagegen nur verstanden werden, wenn das Höhere selbst schon bekannt ist. Die bürgerliche Ökonomie liefert so den Schlüssel zur antiken etc. Keineswegs aber in der Art der Ökonomen, die alle historischen Unterschiede verwischen und in allen Gesellschaftsformen die bürgerlichen sehen.“ (Karl Marx: Grundrisse, Einleitung [zur Kritik der Politischen Ökonomie], 1857, MEW 13, S. 636)
| Reliquienkreuz, vermutlich aus dem Rheinland, 2. V. 14. Jahrhundert, vergoldetes Silber mit Achat, Opal und Bergkristall. |
| Anna Pawlik schreibt in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein: „Auf der Vorderseite ist ein ornamental bearbeitetes, teilweise mit goldener Farbe bemaltes Pergament eingelegt, auf dem die Reliquien verzeichnet sind. (…) Die zwei kreuzförmig übereinanderliegenden Holzpartikel in [sic] Zentrum des Pegaments sind durch die umlaufende Inschrift De sancta cruce domini als Kreuzreliquien gekennzeichnet, Die Rückseite des Behälters ist mit einer silbervergoldeten, kreisförmigen Platte mit getriebenem Christuskopf in einer Mandorla verschlossen.“ |
Erste Antworten
Ich hatte geplant, mich zunächst mit der so genannten Asiatischen Produktionsweise auseinanderzusetzen. nachdem ich jetzt noch einmal Erich Pilz „Zur neuesten (1982!) Debatte über die Asiatische Produktionsweise in der Volksrepublik China“ gelesen hatte, erscheint mit das jetzt überflüssig. Die (…) aufgezählten Produktionsweisen sind also logische Abstraktionen, reine Wirtschaftsformen und deren logische Reihung,
rarbeitet beim Studium der politischen Ökonomie. Wer so eine Produktionsweise mit einer Periode der Gesellschaftsentwicklung gleichsetzt, der wird den methodischen Voraussetzungen bei Marx (logische Methode versus historische Methode) absolut nicht gerecht. Das heißt: Es wäre vermutlich falsch, überall in der Geschichte zu suchen, ob eine Gesellschft dem „Modell“ APW ähnelt oder nicht und warum. Das bewiese gar nichts. Die APW ist also ein aus der konkreten Geschichte abstrahiertes ökonomisches Universale.
Man kann nur einen Umkehrschluss ziehen. Die Aristokratie oder Bürokratie (vgl. das alte Mesopotamien oder China) organisiert die produktive Arbeit und eignet sich einen Teil des Mehrprodukts der unmittelbaren Produzenten an. Im mitteleuropäischen Feudalismus kann von einer „Organisation“ der gesellschaftlichen Arbeit aber kaum gesprochen werden. Ganz im Gegenteil: Vor dem Absolutismus spielen eine Staatsmacht oder gar eine Bürokratie kaum eine Rolle für die Ökonomie. Dort aber gab es Kapitalismus zuerst. Oder, abstrakt ausgedrückt: Die Produzenten werden vollends von ihren Produktionsmittel am effektivsten getrennt, wenn eine Art europäischer Feudalismus vorhanden ist. Daraus kann man aber die letzte der obigen Fragen nicht beantworten: Die Ökonomie Chinas war auf dem Weg zum Kapitalismus eher „langsamer“, aber bedeutet das zwangsläufig, dass sich post-kapitalistische Formen dort am ehesten herausbilden können? Oder war es eine Kette von Zufällen? Das erscheint mir unwahrscheinlich, wenn man China mit Indien vergleicht.
Hierzu Pilz, der chinesischen Autoren zitiert (daher vermutlich der Begriff „Volk“, der von Marx so nicht benutzt worden wäre): Das grundsätzliche Mißverständnis bisheriger Interpretation der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen bei Marx liege darin, dass man jedes einzelne Volk alle Stufen durchlaufen sieht. Marx hingegen sah die Gesamtheit der Menschheitsentwicklung: Zu gewissen Perioden haben die Entwicklungsstufen gewisser Völker exemplarische Bedeutung, weil ihre Produktionsweisen zur Gesamtentwicklung besonders bedeutende Beiträge geleistet haben. Manche Völker haben lange keine nennenswerten Beiträge geleistet, um dann gewaltig hervorzutreten und wieder zurückzufallen (=nicht auf die nächst höhere Produktionsstufe zu kommen). Die Übernehmer solcher Beiträge hingegen waren oft fähig, darin eingebaute Hemmnisse zu überwinden. Was ist aus dem großartigen Ägypten, was aus Assur geworden? Kein Volk, auch kein europäisches, hat alle von Marx genannten Stufen durchlaufen. Für Marx war die Asiatische Formation beispielhaft innerhalb eines bestimmten Zeitraumes – so wie Griechenland und Rom beispielgebend waren für die Sklavengesellschaft. Die APW stellt also keine Erscheinungsform eines bestimmten Gebietes dar, aber innerhalb der Gesamtentwicklung eine modellhafte Stufe und ist damit von allgemeiner Gültigkeit.
Offenbar war man sich damals – bei Erscheinen der Pilzschen Zusammenfassung – in China sogar fast einig, dass dort weder eine „Asiatische Produktionsweise“ noch eine „Sklavenhaltergesellschaft“ wie im Marxschen theoretischen Modell existiert hat.
Das beantwortet auch meine Frage: Es gibt nur ein „logischen“ Schema, wie die Menschheit sich von einer klassenlosen „Urgesellschaft“ bis zur Klassengesellschaft im Kapitalismus entwickelte, aber mitnichten eine historische Abfolge. Die Frage, ob es für den Kapitalismus vor dem Feudalismus einer Sklavenhaltergesellschaft bedürfe oder nicht, ist also falsch gestellt und unsinnig.
Eine witzige Pointe ist, dass es vor mehr als vier Jahrzehnten in der marxistischen Diskussion offenbar nicht „opportun“ war, einen Zusammenhang zwischen historischen Elementen der „Asiatischen Produktionsweise“ und der Gefahr des Bürokratismus in sozialistischen Staaten Asiens zu vermuten. Dieses Thema war schon zu Beginn der chinesischen Kulturrevolution aktuell, wenn nicht sogar der Anlass. Heute könnte man polemisch entgegen, diese bürokratischen Elemente hätten genau das Gegenteil bewirkt – dass der chinesische Staatskapitalismus oder – in deren Parteineusprech – der Sozialismus chinesischer Prägung sich gerade deshalb als besonders stabil und progressiv (gegenüber dem „westlichen“ Kapitalismus) erwiesen hat.
Wird fortgesetzt.
| Reliquiar, vermutlich letztes Drittel 14. Jahrhundert. Im Unterschied zu allen anderen Reliquiaren hat dieses eine rechteckige Grundform. Angeblich enthält es Reliquien der Margareta von Antiochia, der Christina von Bolsena, der Agnes von Rom, der Felicitas sowie den üblichen „Hausheiligen“ des Essener Doms. Auf einem Pergament steht de S(an)c(t)a elisabeth und De capillis Elisabeth(i)na v(…). Vermutlich war die Stiftern die Äbtissin Elisabeth von Nassau-Hadamar. |
| Ostensorium, vermutlich Rheinland, vor 1450, vergoldetes Silber, getrieben und gegossen, 57, 2 cm hoch. Die Details sind zum Teil unfassbar winzig – wie die kleinen Heiligenfiguren und die Wasserspeier seitlich der Baldachine. |
| Paxtafel, auch bekannt als Kusstafeln, gegossenes Silber, graviert, Bergkristall. Nur Kleriker durften diese Dinge küssen. „Das Küssen des Reliquienbehälters galt dabei in besonderer Weise als heilbringend, bei besonderen Anlässen konnte er zudem zur Gewährung eines Ablasses dienen. Der Brauch setzte sich bereits im 13. Jahrhundert durch.“ |
| Agraffen (hier: Schmuckschließe), französisdch-burgundisch, nach 1360, Goldemailplastik, alle kleiner als fünf Zentimeter Durchmesser. Diese Schmuckstücke sind extrem selten, nur wenige wurden erhalten. Um 1400 waren diese solche Agraffen der letzte modische Schrei an den Höfen der herrschenden Klasse. Sie waren nicht nur ein Kapitalanlage, sondern beschrieben die interne Hierarchie durch Zeichen und das aristokratische Selbstverständnis. „Prachtentfaltung“ ist eine Seite der feudalen Existenz. Ich schrieb hier 2019: Die Feudalklasse kann die Realität erkenntnistheoretisch nur verzerrt wiedergeben, da sich sich nur per Gewalt und Konsum auf die Natur bezieht. Man kann diese notwendige ideologische „Behinderung“ (ähnlich wie Religion) mit dem Waren- und Geldfetisch vergleichen – eine nur ökonomische Form wird von den Akteuren als Eigenschaft des Dings an sich angesehen. Deswegen glaubt auch die FDP an den „Markt“ als eigenständig handelndes höheres Wesen – ähnlich wie ein feudaler Adliger des 10. Jahrhunderts eine Reliquie als magisches wirkmächtiges Objekt ansah. |
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Jenseits des Oxus

„Die Hauptursachen für die Stagnation der Produktivkräfte und für die unerträgliche Lage des Volkes Afghanistans sind die ökonomische und politische Herrschaft der Feudalherren, die Raffgier der Großschieber und der Kompradorenbourgeoisie, die durch und durch verfaulte Bürokratie und die Aktivitäten der internationalen imperialistischen Monopole.“ (Grundsatzprogramm der Demokratischen Volkspartei Afghanistan (DVPA) vom 1. Januar 1965)
Kurz zwischendurch müssen wir die Perspektive vergrößern und uns die weite Welt ansehen, insbesondere Afghanistan. Thema: Der Kapitalismus hat sich zuerst in Nordwesteuropa entwickelt. Das heißt soziologisch: Die vorherrschenden Produktionsverhältnisse fußen auf „freien“ Arbeitern, die nichts mehr besitzen als ihre Arbeitskraft. Technisch: Die industrielle Revolution emanzipierte den Menschen von den „natürlichen“ Energien wie Wind- und Wasserkraft (ich weiß, sehr verkürzt).
Hieraus ergeben sich unmittelbar weitere theoretische Fragen: a) Der europäische Feudalismus war offenbar ein Sonderweg. (Beim gegenwärtigen Stand der historischen Forschung könnten sich „bürgerliche“ und „marxistische“ Historiker vermutlich darauf einigen.) In anderen Regionen der Welt gab es feudale Verhältnisse auch, etwa in Japan, aber der Kapitalismus entwickelte sich dort viel langsamer, wenn überhaupt. b) Braucht es eine Sklavenhaltergesellschaft vor dem Feudalismus – oder ist das Römische Weltreich ebenfalls ein zu vernachlässigender Sonderfall? c) China ist heute die einzige Gesellschaft, in der sich Ansätze entwickeln, die zu nachkapitalistischen Produktionsverhältnissen führen könnten (Möglichkeitsform!). Dort gab es aber keine Sklavenhaltergesellschaft, sondern eine Ökonomie, die man im weiteren Sinn als „Asiatische Produktionsweise“ bezeichnen sollte (meinetwegen auch hydraulische). Könnte es sein, dass dieser Weg letztlich derjenige ist, der den Kapitalismus zuerst überwinden wird? Oder sind zu viele Variablen im Spiel? (Ich taste mich langsam vor auf dem schmalen Pfad zur Erleuchtung.)
Mir war der beschränkte Blick nur auf Europa schon immer suspekt. Ein Blick auf die Weltkarte (Amerika, Afrika und Australien sind irrelevant bei diesem Thema) und die Zeitschiene der letzten zwei Jahrtausende zeigt die Dimension: Zwischen China und Europa liegt ein riesiges Gebiet, das so groß wie das Römischen Weltreich ist, aber dessen Geschichte kaum jemand kennt. Und mittendrin (das heutige) Afghanistan.
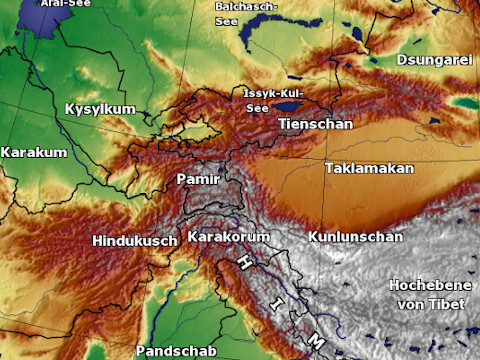
Die Geografie der Welt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik vom Beginn unserer Zeitrechnung bis zur industriellen Revolution könnte man in einer Schulstunde abhandeln. Östlich von Griechenland und dem Römischen Reich waren immer die „Perser“ (die Achämeniden ab dem 6. vorchristlichen Jahrhundert, dann die Parther und Sassaniden bis zur Eroberung durch die Araber).
Erstaunlich ist, dass sich die Sphären, wer wo Einfluss hatte, seit zweitausend Jahren nicht wesentlich geändert haben. Nur Alexander der Große durchbrach diese „Logik“, weil er bis nach Indien kam (eigentlich nicht Indien, sondern Afghanistan und Pakistan), mit weit reichenden Folgen, aber umgekehrt versuchte es niemand. Falls die Keilerei bei Issos und das Hauen und Stechen bei Gaugamela anders ausgegangen wäre, hätten die Griechen Tribut an die Achämeniden zahlen müssen, aber die „Perser“ wären aus nachvollziehbaren logistischen Gründen vermutlich nicht so weit westlich wie Hannibal gekommen.
Und der Norden? Die Perser haben versucht, die Steppen im Süden des heutigen Russlands zu beherrschen. Das ging, wie wir schon besprochen haben, gründlich schief. Auch die Römer kannten das Kaspische Meer (Caspia regna), blieben aber nicht dauerhaft dort (nur ganz kurz). Und im Südosten war, trotz unzähliger Scharmützel, der Euphrat mehr oder weniger die Grenze – wie der Oxus im Nordosten.
Die Geografie zeigt, dass Baktrien, also der heutige Nordwesten von Afghanistan, unter Einfluss Griechenlands blieb und auch via Persien erreichbar war. Aber den Hindukusch, den Pamir im heutigen Tadschikistan und das Karakorum mit seinen Achttausendern überklettert man nicht einfach so, geschweige denn mit einer Armee.
Die Weltkarte des Herodot zeigt im vierten vorschristlichen Jahrhundert den Indus, aber nicht wirklich das heutige Indien. Der Osten ist terra incognita.
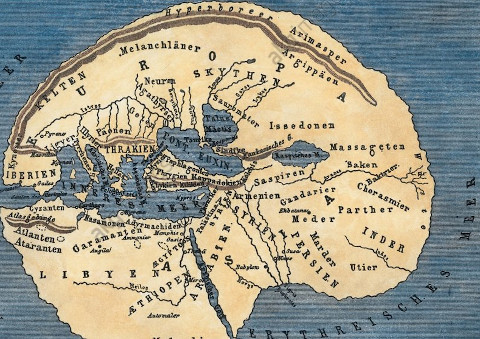
Nur die Seidenstraße verband Westeuropa mit China. Sie führte von Persien ins Ferghanatal, das erst im 6. nachchristlichen Jahrhundert von Steppenvölkern aus dem Norden erobert wurde, bis nach Gandhara im heutigen Pakistan, also auf der östlichen Seite des Hindukusch.
Ein weiteres Netz von Straßen war in Transoxanien, nördlich des Oxus (heute Amurdaja), der aber damals in den Aralsee floss und heute schon vorher versickert. Der Handelsweg nach und von China verlief über Samarkand und Buchara (Buxoro) im heutigen Usbekistan. Dort spricht man heute noch eine Variante des Persischen, genauso wie die Hazara im Westen Afghanistans. (Ich habe selbst Flüchtlinge der Hazara in der Notaufnahme in Kreuzberg getroffen – man erkannte sie meistens, wenn sie aus Afghanistan kamen, an ihren „asiatischen“ Gesichtszügen, und sie sprachen selten Dari-Farsi oder noch seltener Paschtu.)

Die Seidenstrasse bei Bamiyan, Afghanistan, credits: Hadi Zaher/Flickr
In China und Japan hat man römische Münzen gefunden. Der chinesische Kaiserhof war durchaus über Rom informiert, wenn auch nur vage. Vermutlich sagte man im Reich der Mitte: So ähnlich wie die Perser (Parther) oder Kuschana, nur ein bisschen weiter weg. „Minor Kings“ eben.
Auch die Chinesen hatten – fast zeitlich parallel – ihren Spartakus, zur Zeit der Han-Dynastie. Die Anführer der Aufstände hießen Chen She und Wu Guang. Aber es handelt sich nicht, wie im alten Rom, um Sklavenaufstände, sondern um Rebellionen von Bauern, die zu „staatlichen“ Arbeiten herangezogen werden sollten – angeblich mit einer Armee von rund 300.000 (!) Mann, Es wäre auch interessant, die Rolle des ehemaligen Bauern Han Gaozu zu untersuchen, der als Folge des Klassenkämpfe sogar Kaiser von China wurde.
Ich weiß leider zu wenig über chinesische Geschichte, aber ich musste hier natürlich an die berühmte Passage aus dem Kommunistischen Manifest denken:
Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zu einander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.
Der „gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen“ beschreibt korrekt den Untergang des Römischen Reiches. Auch Han Gaozu ließ die Produktionsverhältnisse so „feudal“ wie sie waren, milderte nur den Druck auf die Beherrschten. „Han-Kaiser Gaozu ließ den Verwaltungsapparat der Qin-Dynastie weiterbestehen und hielt an der Mehrzahl ihrer Gesetze und Verordnungen fest, sogar an dem Bücherverbot. Zumindest wurden Strafrecht und Steuern gemildert.“
Spannend wird es, wenn man den Satz auf Wikipedia liest: Zur Zeit der Qin- und der Han-Dynastie wurde im Kaiserreich China die Macht der Lehnsträger, d.h. des Adels beseitigt und das Lehnswesen abgeschafft. Das Reich wurde endgültig zentralisiert, in Provinzen gegliedert und durch einen Beamtenapparat verwaltet.
Lehnswesen in China? Der Begriff ist hier natürlich Bullshit-Bingo, zumal sogar die bürgerliche Geschichtswissenschaft anzweifelt, ob „Lehnswesen“ auf den Frühfeudalismus (Karolinger-Zeit) oder gar das so genannte „Hochmittelalter“ zutrifft. Der Begriff beschreibt ein bestimmtes Verhältnis innerhalb der herrschenden Klasse und ist für unser Thema nicht relevant. Aber man muss sich schon Gedanken machen, was in China anders war oder auch nicht.
Es gibt etwas, das Indien, China und das Römische Reich ab der Kaiser-Zeit gemeinsam haben: Die herrschende Klasse modifizierte sich so weit, dass ehemalige Sklaven und Mitglieder anderer unterdrückten Klassen sozial aufsteigen konnten. Das Sultanat von Dehli im 13. Jahrhundert war sogar eine Sklavendynastie. Die soziale Herkunft der Herrschenden spielt aber de facto keine Rolle. Ob ein Bauer oder Freigelassener Minister oder Kaiser oder ein Mameluke Sultan werden konnte – wichtig sind nur die Produktionsverhältnisse. Die bleiben gleich. Sowohl in Indien als auch in China gab es Sklaven, die Produktion mit ihnen wurden aber nicht, wie im Römischen Reich, zur vorherrschenden Form, auf der die ganze Ökonomie beruhte.

Zhang Qian verlässt Kaiser Wu. Frühe Tang-Dynastie, Mogao-Grotten, China
Afghanistan und vor allem das obige Zitat der dortigen „Linken“ zeigen das ganz gut. Die Textbausteine hat sich sicher irgendein stalinistischer Funktionär in Moskau ausgedacht. Es taucht alles auf, was damals en vogue war: Feudalherren, Großschieber (Finanzkapital!), Kompradorenbourgeoisie (die Kapitalisten kooperieren mit dem ausländischen Feind – in China hießen die wirklich so) – und die „internationalen imperialistischen Monopole“. Alle anderen sind schuld, aber in Afganistan brachten sich die „Linken“ auch gern gegenseitig um. Und wer in Afghanistan vom „afghanischen Volk“ spricht, wird vermutlich für geistig gestört gehalten.
Afghanistan war damals auf dem Stand Mitteleuropas zur Zeit des Absolutismus.
Die afghanische Gesellschaft war nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu in jeder Hinsicht durch sozialökonomische Rückständigkeit charakterisiert. In ganz Afghanistan herrschten feudale und teilweise sogar vorfeudale Verhältnisse, wobei die feudalen Verhältnisse auf dem Lande dominierend waren. 90% der Bevölkerung lebten auf dem Lande, ca. 70% des bebaubaren Bodens und die meisten Bewässerungsanlagen waren im Besitz von Großgrundbesitzern. Landarme Bauern, die zwischen 33 und 40% aller Bodenbesitzer stellten, verfügten über nicht mehr als je einen Hektar Land. Nach unterschiedlichen Einschätzungen hatten zwischen 18 und 35% aller Bauernwirtschaften überhaupt kein bebaubares Land, wobei der größte Teil von ihnen weder Vieh noch irgendeine andere Art von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln besaß. Die großen Viehzüchter hatten den größten Teil der Viehweideplätze unter ihrer Kontrolle. Die landwirtschaftliche Produktionsweise war sehr primitiv, und das Produktionsvolumen fiel demgemäß niedrig aus. Denn die Großgrundbesitzer investierten nicht in diesem Bereich, sondern setzten ihr Kapital im gewinnträchtigeren Handel ein.*
Die Probleme und die innere Dynamik einer vorwiegend agrarischen Gesellschaft bleiben also auch immer gleich, von den Gracchen im 2. vorchristlichen Jahrhundert bis zum Transoxanien und Afghanistan im 20. Jahrhundert: Es geht nur darum, wer den Boden besitzt und wer darauf produzieren darf. In einem theoretischen Modell wären in Afghanistan die besitzlosen Bauern in die Städte abgewandert, freiwillig oder gezwungen, wie zur Zeit der industriellen Revolution in Europa. Wenn die Bourgeoisie aber nur handeln will und sich nicht um die Produktion kümmert, wird das nichts mit dem Kapitalismus. Der Zug war aber für die „Dritte Welt“ ohnehin abgefahren – und das gilt jetzt auch für Südamerika und Afrika – weil die imperialistischen Mächte (also die Industriestaaten, die am schnellsten auf dem Weg zum Kapitalismus waren), die Märkte schon mit ihren Produkten kontrollieren.
Vorläufiges Fazit: In China hat sich eine zentralistische „Verwaltung“, auf der der ganze Staatsapparat und auch die Produktion fußt, wesentlich früher entwickelt als in Europa. In Indien war das nicht so. In Frankreich und in Preußen gab es das erst vergleichbar erst im späten 16. Jahrhundert, also zur Zeit der Manufakturen, den Vorläufern der Fabriken.
* Martin Baraki: Die „goldenen Zeiten“ am Hindukusch – Afghanistan nach dem Zweiten Weltkrieg (Teik 1), in Z – Zeitschrift für Marxistische Erneuerung, Nr. 128, Dezember 2021
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Capitulare de villis
Nur eine Vorschau für das Stammpublikum, was Euch im nächsten Jahr blüht. Manchmal ist es einfach schön, die Quelle für dieses und jenes – hier „Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Grossen: (Capitulare de Villis Vel Curtis Imperii.)“ – im Original zu überfliegen, zumal wenn sie bezahlbar ist. Vielleicht sollte ich mal einen eintägigen Bildungsurlaub in Wolfenbüttel oder online machen.
Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V)
Theophanu-Evangeliar, um 1050, Pergamenthandschrift. Im 18. Jahrhundert wurde die Handschrift aus den Deckeln (unten) gelöst und in Leder eingefasst.
Katrinette Bodarwé schreibt in in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein: „Der Liber ordinarius schildert insbesondere die Rolle dieser Handschrift, die als Pleonarius bezeichnet wird, in der österlichen Liturgie. Auf der Westempore wurde am Karfreitag ein Zelt als Ostergrab errichtet, in dem das Evangeliar zusammen mit dem: silbernen Kreuz vom Kreuzaltar und wahrscheinlich dem Tafelreliguiar mit dem Kreuznagel Christi und einigen anderen Reliquien bestattet wurde. Am Ostermorgen wurden diese Heiltümer als Zeichen der Auferstehung in einer feierlichen Liturgie unter Beteiligung der Kanonissen wieder erhoben.“
Das Evangeliar war schon damals ungeheuer kostbar und das Beste, was Künstler und Handwerker zu der Zeit aufbieten konnten. Die Äbtissin war aber Enkelin Kaiser Ottos II. und seine berühmten Frau Theophanu aus Byzanz, ihr Bruder Hermann der Erzbischof von Köln. Sie war in ihrer Epoche im Vergleich so wohlhabend wie heute Susanne Klatten.
Buchdeckel und Rückseite des Theophanu-Evangeliars. Der vordere Deckel (35,7 x 26 cm) hat einen Kern aus Eichenholz und ist mit Goldblech und einer Platte aus Elfenbein belegt, angefertigt von einem Künstler aus dem Raum Köln-Lüttich. Das untere Feld des Randes zeigt das Stifterbild. In der Mitte Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß. Zu ihren Füßen kniet die Äbtissin Theophanu (Beischrift THEOPHANV ABBA[TISS]A), die das von ihr gestiftete Evangeliar zu Füßen der Thronenden ablegt. Seitlich Pinnosa und die heilige Walburga, in den beiden seitlichen Feldern die Essener Stiftspatrone Petrus und Paulus (oben) sowie Kosmas (auch Cosmas) und Damian (unten) unter Arkaden. Oben halten zwei Engel eine Mandora über dem Pantokrator. Der Deckel ist wie ein spätantikes (!) fünfteiliges Diptychon gegliedert – der Künstler wollte offenbar die damals schon ferne Vergangenheit zitieren.
Aber wieder zum eigentlichen Thema. In Agrarisch und revolutionär I ging es um die „zweigeteilte Grundherrschaft“ (Villikation) als Basis des mitteleuropäischen Feudalismus. Laut Michael Mitterauer Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs finden wir hier die Basis dafür, dass sich der Kapitalismus in Mitteleuropa einschließlich England zuerst entwickelt hat.
Ich schrieb in Agrarisch und revolutionär II: Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert setzte voraus, dass die Wasserenergie durch andere Energieformen ersetzt wurde. Die ökologische Basis schaffte hier Europa einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung.
Im Detail ist es natürlich komplizierter. Was genau diese Villikation [der Wikipedia-Eintrag ist noch nicht einmal auf dem Niveau von Proseminaren im 1. Semester] bedeutet, sieht man dann, wenn man diese Form der Klassenherrschaft mit den Gebieten vergleicht, wo das nicht so war. Offenbar sind Ackerbau und Getreidewirtschaft wichtig: In Friesland dominierten eher die Viehzucht und Textilgewerbe (vor allem Schafwolle) – eine „zweigeteilte Grundherrschaft“ hat sich dort nicht ausgebildet. Auch nicht in Irland – aus ähnlichen Gründen wie bei den Friesen – wohl aber in England unter Alfred dem Großen.
Mitterauer schreibt: Viel weiter zurückreichende Strukturübereinstimmungen mussen dafür die Voraussetzungen gebildet haben. Anders als Irland aber ebenso wie das nördliche Gallien war auch Britannien von provinzialrömischen Mustern geprägt* – von der Civitas-Verfassung, von ländlichen «villae rusticae» mit ihrer Latifundienwirtschaft, von den ökonomischen Bedürfnissen der Heeresversorgung in einer gefährdeten Grenzregion. (…) Zum vorgefundenen Bestand gehörten vor allem alle jene Getreidearten, auf die im Frühmittelalter im Frankenreich die entscheidenden agrarischen Innovationen aufbauten. Den Weg der fränkischen Agrarrevolution konnten die Angelsachsen also von vornherein mitgehen, und damit auch die Entwicklung der auf verstärkten Getreidebau basierenden «zweigeteilten Grundherrschaft» mit ihren charakteristischen Pflugfronen.
Vielleicht bin ich jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der das spannend findet: Hier haben wir ein starkes Argument, dass die antike Sklavenhaltergesellschaft als Basis die Ökonomie im Frühfeudalismus antrieb. Man kann nicht behaupten, dass Latifundien und das Kolonat die conditio sine qua non waren, aber wenn sie als Grundlage existierten, beschleunigten sie offenbar die Agrarrevolution. Und das war nur im Frankenreich und in England so. In anderen Regionen des ehemalige römischen Reiches stimmte die Ökologie nicht. Die Voraussetzungen in bestimmten Regionen Europas für das „Wettrennen“ zum Kapitalismus waren also durchaus exotisch, so dass Mitterauer mit der These, es habe sich um einen „Sonderweg“ gehandelt, recht haben könnte.
Jetzt erscheint die von mir schon fast verworfene Frage bzw. These marxistischer Theoretiker in einem anderen, sogar vorteilhafteren Licht, ob der Feudalismus sich nur dann zum Kapitalismus entwickele, wenn er auf der Sklavenhaltergesellschaft fuße – oder ob es theoretisch auch ohne ginge. Da kein Paralleluniversum existiert, in dem wir das testen könnten, ist die Antwort einfach: Die These der angeblich zwangsläufig aufeinanderfolgenden Gesellschaftsformationen sagt nur etwas über die Geschwindigkeit aus, mit der letztlich der Kapitalismus in England zuerst entstand. Da die kapitalistischen Staaten Mitteleuropas in kurzer Zeit fast die ganze Welt unterjochten und der ihre Ökonomie aufzwangen (wie auch die Römer den unterworfenen Völkern), bleibt die Frage rein hypothetisch, was etwa aus China geworden wäre, wenn es keine Weltkriege und eine japanische Okkupation, keinen Langen Marsch und keine Revolution gegeben hätte.
Im 12. Jahrhundert löst sich die Villikation allmählich auf. Das, was in der bürgerlichen Geschichtswissenschaft als „Hochmittelalter“ bezeichnet wird, ist nur eine variierte Form der Klassenherrschaft: Es geht immer darum, wie den Bauern und Handwerkern der Mehrwert abgenommen wird, ob durch den Kriegeradel direkt oder die Klöster oder deren Helfershelfer – das spielt keine Rolle.
Steht vor der Jahrtausendwende noch die Mehrarbeit (Fron) der Bauern für den Feudalherrn im Vordergrund, wird dieses System später mehr und mehr verdinglicht in Form von Abgaben – bis hin zur Geldrente. Abhängig bleiben die Bauern immer – bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert waren neun Zehntel der deutschen und vier Fünftel der europäischen Bevölkerung abhängige Bauern. Um klarzumachen, was das bedeutet: Seit der Zeit Karl des Großen hatte die Feudalklasse es geschafft, sich fast die gesamte arbeitende Bevölkerung untertan zu machen und auf deren „Kosten“ zu leben. Das kann man ultrakurz auf den Punkt bringen: Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?
Der Klassenkampf geht für die Bauern immer darum, sich von Herrschaft und Abgaben zu befreien. Oft kämpften sie zuerst um die Allmende – aber gegen die militärische Übermacht konnten sie langfristig nicht bestehen. Andere wichen der direkten Konfrontation aus, indem sie versuchten auszuwandern, vor allem in den Osten, wo sie mehr Freiheiten bekamen als Gegenleistung für das Roden und Urbarmachen der unwirtlichen Gebiete. Die Zahl der Aufstände gegen die Feudalherrschaft kann man sicher vergleichen mit der Anzahl kleiner und großer Streiks in der Moderne.
Unten: Kleines karolingisches Evangeliar aus der 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts, Pergamenthandschrift mit Zierseiten und insgesamt 240 Blättern. (Rainer Teuber)
Fortsetzung folgt.
* Rosamond Faith: The English Peasantry and the Growth of Lordship (Studies in the Early History of Britain)
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV)
Warnhinweis: Mitgliedern arabisch-kurdischer Clans ist es nicht erlaubt, diesen Beitrag zu lesen. Bei Zuwiderhandlung wird der Täter von vielen alten, kleinäugigen und männlichen Jungfrauen im Paradies erwartet werden.
Theophanu-Kreuz, um 1040/1045, und Rückseite. Die Senkschmelze an den Kreuzenden stammen von einem unbekannten Objekt vermutlich byzantinischer Herkunft. Durch den großen Kristall in der Mitte kann man die Reliquie betrachten – einen Nagel vom Kreuz Christi (magisches Denken: pars pro toto, vgl. Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II))
Auch wenn das mediävistisch interessierte Publikum jetzt ächzen wird: Wir müssen kurz und zwischendurch die Methode zum Pfad der Erleuchtung analysieren, die hier angesagt ist. Es gibt sehr viele Variablen, als da wären:
– Reliquien setzen magischen Denken voraus. Magie gibt es aber immer und überall; auch Esoterik im Kapitalimus funktioniert nach den hier schon geschilderten Gesetzen der Magie. Gehörte diese Art objektivierter Magie zwingend zum Feudalismus?
Reminder: Objekte sind dingliche bzw. verdinglichte Zeichen der sozialen Hierarchien und der Rituale.
Auch im Shintoismus in Japan werden Reliquien verehrt. Und erfreulicherweise auch im vorkapitalistischen China (wenn das nicht so wäre, stimmte meine These nicht). Das widerspricht auch nicht der Marxschen These, dass der Feudalismus in Japan zum Beispiel noch „typischer“ sei als der in Mitteleuropa, was die Klassenverhältnisse betrifft.
– Arbeitshypothesen: a) Religion ist nur eine Teilmenge magischen Denkens. b) Das Christentum gehört nicht unbedingt zum Feudalismus, wohl aber objektivierte ritualisierte Magie.
– Wie unten beim Corneliuskult gezeigt, unterscheidet sich also der „Überbau“ der herrschenden Klassen mitnichten von der Alltagspraxis der Bauern und der Handwerker. Das magische Denken „überwölbt“ alles. Die kostbaren Reliquien der Domschätze sind also nur die Spitze des weltanschaulichen Eisbergs: Was für eine Äbtissin das Theophanu-Kreuz war, war für das einfache Volk ein einfaches Kästchen oder das Anrufen eines Heiligen bei der Fallsucht (Epilepsie). Deswegen gibt es im Katholizismus mehr als 10.000 Heilige und Märtyrer, also knapp 30 pro Tag – da ist für jeden etwas dabei.
Essener Krone aus des 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts. Bis ins 16. Jahrhundert wurde diese Krone jedes Jahr zu Maria Lichtmess (2. Februar) der Goldenen Madonna (entstanden um 980, die ich nicht fotografiert habe*) in der Schatzkammer aufgesetzt. Die wiederum wurde bei Prozessionen mitgeführt. Die Krone ist an mehreren Stellen leicht beschädigt, vielleicht bei sehr frühen Versuchen, etwas zu restaurieren oder zu ändern. Eine der vier goldenen Lilien wurde geringfügig versetzt.
Birgitta Falk schreibt in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein über die These, die Krone sei mit Absicht verkleinert worden „Sie sei ursprünglich bei der Krönung des dreijährigen Kindes Otto III. verwendet worden, der 983 in Aachen zum Mitkönig des Römischen Reiches gekrönt wurde. (…) Die stilistische Diskrepanz zwischen dem Filigran auf dem Grund des Kronreifs, den aufwendigen Fassungen sowie den eleganten „Spinnen“ gibt allerdings Rätsel auf.“ Entweder entstand die Krone im 19. Jh. und wurde in ein Jahrhundert später umfassend umgearbeitet oder sie ist erst in der 2. Hälfte des 11. Jh. unter den Äbtissinnen Theophanu und Svanhild entstanden.
Mitte: Ostensorium, Mitte 14. Jahrhunderts, vergoldetes Silber, getrieben, gegossen, graviert, emailliert. „Es handelt sich um das älteste bekannte Beispiel einer Turmmonstranz, bei welcher der Zylinder von zwei seitlich angebrachten Streben begleitet wird. Die Monstranz wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt in ein Reliquienostensorium umgewandelt.“ (Unteres Foto: Detail – in Stoff eingenähte Reliquie der Heiligen Andreas), Paulinus und Severin.
„Die Darstellung des Pelikans auf der Turmspitze belegt, dass es sich bei dem Ostensorium ursprünglich um eine Hostienmonstranz handelte. Dieser Verwendungszweck erforderte einen abnehmbaren Turmaufbau, um das Einsetzen der konsekrierten Hostie in den Kristallzylinder zu ermöglichen. Aus diesem Grund sind die Streben, die den Oberbau mit dem Turmaufbau verbinden, nicht verlötet, sondern durch Schrauben verbunden. Die paarweise angebrachten Einzelbuchstaben und Kreuze dienten möglicherweise dazu, dem konsekrierenden Priester das Öffnen der Monstranz zu erleichtern, indem sie die Stellen, an denen die Streben gelöst werden konnten, markierten“.
Obiges Bild rechts: Ostensorium um 1350/1375. Drei Bergkristallzyliner – die beiden größeren enthalten Reliquien der Heiligen Cornelius ** und Simeon.
Obiges Bild links: Ostensorium aus dem 15. Jahrhundert. Im Glaszylinder in der Mitte sind Reliquien und hinter dem Fenster des Turms. Der gesamte Turmaufsatz lässt sich abnehmen.
Kapselmonstranz der Äbtissin Elisabeth von Nassau, 1385, vergoldetes Silber, gegossen und graviert, Bergkristall und Email. Höhe 56 cm. Die Dame war wohl sehr durchsetzungsfähig und „regierte“ mehr als vier Jahrzehnte. Sie ließ sich sogar von Rat und Bürgerschaft der Stadt Essen huldigen und setzte es durch, dass die Richter vor „ihrem“ Stift vereidigt wurden. Die Bürger mussten lange kämpfen, um wieder unabhängig von der Äbtissin zu werden.
| A | eliz · abet de nassauwe // abb(atiss)aa) essnden(sis)a) · m° c°c°c°lxxxvb) |
| B | e |
| C | e |
| D | s(anctus) geor/gius |
| E | s(anctus) (ch)ri/stoforc) |
| F | s(ancta) ursu/la |
| G | pingn/osa |
| Übersetzung: | Elisabeth von Nassau, Äbtissin von Essen 1385. |
Für hier mitlesenden Alt-, Mittel- und Neugermanisten haben wir noch ein Schmankerl: „Die heilige Pinnosa wurde bereits im 10. Jahrhundert in Essen besonders verehrt. Ihre Reliquien kamen sicher gemeinsam mit Reliquien der heiligen Ursula aus Köln nach Essen. Die ungewöhnliche, bis jetzt an anderer Stelle nicht belegte Schreibweise pingnosa statt Pinnosa in Inschrift G hängt mit der Velarisierung des Lautwertes 〈n〉 zusammen, die im Frühneuhochdeutschen im main- und rheinfränkischen Gebiet für einige Dialekte belegt ist.“ Es geht also irgendwie um Verengung des Mundraums durch Hebung der Hinterzunge an das Gaumensegel; deswegen schrieb man in Essen den Namen der von den Hunnen dahingemetzelten Jungfrau anders. Aha! (Puls und Atmung noch normal?)
Im Verzeichnis deutscher Inschriften heißt es über die Monstranz: „Der ausladende Fuß aus vier geschweiften Bögen und durchbrochener Zarge läuft in einen sechskantigen Ständer aus. In ein Schriftband auf dem Fuß ist ein Name mit Datum als Stiftervermerk (A) in Kontur vor kreuzschraffiertem Schriftgrund graviert, auf der Vorderseite des Fußes und der Rückseite des sechsseitigen Kapellennodus Einzelbuchstaben (B, C) in Kontur mit Kreuzschraffurfüllung vor glattem Schriftgrund. Die Überleitung in den Oberbau ist mit Weinranken überfangen, links und rechts befindet sich eine Engelsfigur. In der Mitte der Basis ruht auf einer Konsole, die von vier Engeln mit Musikinstrumenten umgeben ist, eine Bergkristallkapsel, in der Herrenreliquien und eine Reliquienauthentik enthalten sind. Die Kapsel wird von Strebewerk begleitet. Darüber erhebt sich ein turmartiger Baldachin. Das unterste Geschoss besteht aus einer über Eck gestellten viereckigen Grundfläche mit Brüstung über vier Kielbögen. Im darüber liegenden Geschoss sind in die vier Fensterbrüstungen Heiligennamen (D–G) graviert, darüber befinden sich Maßwerkfenster, an den Ecken stehen musizierende Engel unter Baldachinen. Im dritten Geschoss steht eine Statuette, darüber befindet sich die Turmspitze mit Kruzifix.“
Angeblich sind in der Bergkristallkapsel ein Tropfen vom Blut Christi, ein Splitter vom Kreuz und ein Dorn der Dornenkrone.
Reliquiar aus dem 14. Jahrhundert, silber und teilvergoldet (14 cm hoch), gegossen, graviert, Bergkristall. Die Statuette des Heiligen Antonius, dem so genannten „Vater aller Mönche“, wurde erst 1950 bei einer Restaurierung angebracht und stammt von einem anderen Ostensorium. Im Kristallzylinder sind eingewickelte Reliquien der Sieben Schläfer von Ephesus ***, des heiligen Chrysanthus und des Florinus.
Fortsetzung folgt
* Sehr interessant aus technischer Sicht: Restaurierungsgeschichte und Zustand
** Das Grab des Bischofs von Rom wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt und konnte Cornelius zweifelsfrei zugewiesen werden. Im 9. Jahrhundert – also zur Zeit der karolingischen Renaissance – entwickelte sich um ihn ein regelrechter Kult im ganzen christlichen Europa. „An verschiedenen Orten wurde Cornelius noch bei weiteren Leiden angerufen, so bei Lahmheit, ansteckenden Krankheiten, Pest, Fieberkrankheiten, Kopfleiden, Blindheit, Hirnhautentzündung, Mutterkornpilz, Ohrenschmerzen, Halskrankheiten, Keuchhusten, Krätze, Warzen, Blutungen, Bruchleiden, Kinderlosigkeit (Ninove in Belgien), Stress und Beziehungsproblemen, gegen Schlaganfall und plötzlichem Tod, zur Erhaltung der Keuschheit und als Patron der Liebenden (Neuss-Selikum).“ (Wikipedia)
*** Die Siebenschläfer werden auch im Islam verehrt.
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III)
Domschatzkammer Essen: Die vergoldete Kupferplatte im Vordergrund ist der Rest des so genannten Ida-Kreuzes (10. Jahrhundert), das nicht mehr erhalten ist. Das Kreuz stand im Dom hinter dem Altar auf einer Säule. 1443 wurde es dort heruntergenommen. Man entdeckte im Innern des Körpers des Gekreuzigten zahlreiche Reliquien. Das Ida-Kreuz wurde durch ein neues Kreuz aus Silber ersetzt; die Reliquien übernommen.
Auf der Platte steht: ISTAM CRUCEM (I)DA ABATISSA FIERI IVSST (Äbtissin Ida befahl, dieses Kreuz machen zu lassen).
Ich muss zugeben: Mit einer der Damen Äbtissinen aus dem 10. Jahrhundert hätte ich gerne diskutiert. Aber dazu müsste ich zuerst mein Althochdeutsch auffrischen und mein Latein ohnehin. Die Frauen aber waren die intellektuelle Elite Europas, hatten Macht und mussten sich permanent gegen die feudalen Schlagetots ringsum absichern. Wahrscheinlich waren sie auch das, was wir heute als „gerissen“ bezeichnen. Wer, wie Mathilde II. – das über Jahrzehnte hinkriegte, war garantiert selbstbewusst genug, um selbst Königen die Stirn zu bieten.
Otto-Mathilden-Kreuz: Das Stifteremail unten (vergrößert) macht das Kreuz einzigartig. Es zeigt die Äbtissin Mathilde II. mit ihrem Bruder Herzog Otto von Schwaben. Mathilde war Enkelin des Liudolfingers und späteren römisch-deutschen Kaisers Otto, der schon damals „der Große“ genannt wurde, ganz bescheiden „totius orbis caput“, das „Haupt der ganzen Welt“.
Für das 10. Jahrhundert gibt es kaum aussagekräftige schriftliche Quellen. Daher sind derartige Objekte von hohem historischen Wert. In Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein liest man: „Das Otto-Mathilden-Kreuz ist das älteste erhaltene Beispiel der Verknüpfung eines edelsteinbesetzten Gemmenkreuzes, das traditionell als Zeichen der Wiederkunft Christi verstanden wurde, und des Kreuzes mit Kruzifixus, das auf die menschliche Natur Christi und seinen Opfertod verweist.“
Das Kreuz ist handwerklich und künstlerisch außerordentlich anspruchsvoll gearbeitet, so dass alle später entstandenen Kreuze es entweder zitieren oder versuchen zu imitieren oder die Form schöpferisch aufgreifen. Mathildes Bruder Otto starb 982 recht jung auf einem Feldzug in Italien, vermutlich an Malaria. Das Otto-Mathilden-Kreuz entstand nach 983, ist also eine so genannte Memorialstiftung. Beide Stifterfiguren auf dem Email sind in höfischer Tracht abgebildet, Mathilde trägt nicht das, was man damals normalerweise von einer Äbtissin erwartete. Die Stifterin handelte also eher als Schwester, als sie ihren Bruder abbilden ließ, denn als kirchliche Funktionärin.
Otto-Mathilden-Kreuz, Rückseite: In der Mitte das Agnus Dei (das Zeichen des katholischen Kosmonauten in Wolfgang Jeschkes Der letzte Tag der Schöpfung!) Das Lamm wird umrahmt von Paradiesranken – ein „Zitat“ der Edelsteine der Kantenrahmung der Vorderseite (sorry für die zwei Genitive hintereinander).
Die herrschende Klasse in den fränkischen Reichen sah sich immer noch als Nachfolger der Caesaren, obwohl das Römische Reich schon ein halbes Jahrtausend vorher untergegangen war. Theophanu, die Nachfolgerin der Mathilde, war Enkelin der berühmten „deutschen“ (Mit)Kaiserin Theophanu aus Byzanz – die unstrittig die wichtigste Frau im 10. Jahrhundert in Mitteleuropa war und im damaligen Sinne Kosmopolitin. Was gäbe ich darum, einmal kurz das zu sehen, was die gesehen haben! (Mal abgesehen davon, dass ein Jahrtausend in der Zukunft – falls man als Zeitreisender die Wahl hätte – natürlich interessanter wäre, aber vermutlich ziemlich verstörend.)
Kreuz mit den großen Senkschmelzen, um 1000: Das Kreuz ist rund zehn Jahre jünger als das Otto-Mathilden-Kreuz und wurde 1020, als Sophie von Gandersheim Äbtissin war, noch einmal umgearbeitet. Statt der Edelsteine an den Kreuzenden wurden Vollschmelzemails mit Ornamenten eingefügt, was handwerklich anspruchsvoller ist: Auf Metall wird flüssiges und farbiges Glas aufgeschmolzen. Das konnten aber schon die Ägypter zwei Jahrtausende vor den Franken und auch die Kelten.
Die Sophie war die Tochter Kaiser Ottos II. und der berühmten Theophanu. Klaus Gereon Beuckers schreibt in Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein dazu: „Seine Funktion im Essener Kreis der Vortragekreuze ist unklar, allerdings legt die demonstrative Umarbeitung unter Äbtissin Sophia eine wichtige Rolle nahe. Sophia war als Äbtissin des Essener Schwesternstiftes in Gandersheim eng mit der bayrischen Ottonenlinie verbunden, der sie durch Kaiser Heinrich II. auch ihrer Essener Position zu verdanken hatte. Sie vertrat damit eine andere politische Ausrichtung als ihre Vorgängerin, die der bayrischen Linie höchst kritisch gegenüber gestanden hatte. Sophias Berufung 1011 in Essen kann als Versuch Heinrich II. gewertet werden, das Stift entgegen der bisherigen Haltung unter Mathilde und entgegen der im Kölner Umkreis geübten Opposition gegen den Bayer politisch zu vereinnahmen.“
So ein paar kleine Emaillearbeiten waren also eine politische Aussage, so wie heute ein Parteiprogramm. Man muss sich vergewissern, dass das Publikum, dem die Kreuze gezeigt wurden, vorwiegend aus Analphabeten bestand und auch die Details ohnehin nicht verstand – das waren ikonografische Interna der herrschenden Klasse. Aber anders konnte nicht „beschrieben“ werden, wer man war und was man wollte.
Mathilden-Kreuz, um 1051/1054: Die direkte Nachfolgerin Mathildes hatte hier ihre Hände nicht im Spiel, sondern deren Nachfolgerin Theophanu, die Enkelin der gleichnamigen Kaiserin. Diese ließ wieder der Mathilde gedenken und nicht deren religiöse Hinterlassenschaften umschmelzen. Das jüngere Mathilden-Kreuz imitiert das ältere. Das Kruzifix ist aber ein Vollguss, eine handwerkliche Kunst, die sich erst im 12. und 13. Jahrhundert durchsetzte. Der Künstler machte damit ein Statement, also hätte jemand schon im 19. Jahrhundert einen Vorläufer des Otto-Motors gebaut.
Ein Detail ist hier anders: Die mit dem Kreuz verehrte Mathilde kniet auf dem Email in weißer, also frommer Tracht, vor der Christusfigur. Sie wird nicht mehr als selbstbewusste höfische Feudaladlige gezeigt.
Das Kreuz wurde in den folgenden Jahrhunderten ziemlich demoliert, sogar die ursprünglichen Emails überschmolzen, und dadurch verschlimmbessert. An die professionelle Handwerkskunst des Originals kam man nicht mehr heran.
Fortsetzung folgt.
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Unter Schlachtjungfrauen
„Krogmann* tilgt in hera das b und übersetzt era mit „Hilfe, Schutz“; duoder bringt er mit einem ad hoc erschlossenen germanischen Wort dõþram zusammen, das „Schaffen, Wirken“ bedeuten soll, und übersetzt era duoder mit „des Heils Wirkerinnen“. Bei dieser Lösung ist zwar nur ein einziger Buchstabe geändert, aber éra („Ehre“) hat im Althochdeutschen nicht die von Krogmann benötigte Bedeutung von „Hilfe, Schutz“, und duoder (bzw. dõþram ) ist nirgends als Bezeichnung von Personen erwiesen. – Wegen dieser Schwierigkeiten hat Kroes diesen Vorschlag verworfen. Er selbst führt, um zu einer anderen Lösung zu gelangen, an den überlieferten Buchstaben durchgreifende Veränderungen durch. Er nimmt falsche Worttrennungen des Schreibers und zudem Fehlschreibung mehrerer Buchstaben an. hera duoder soll für heradu nidar stehen. Hierbei soll heradu der Dativ (Lokativ) erdu (zum Nominativ erda) sein und oder irrigerweise für nidar stehen. Die Bedeutung von heradu nidar wäre dann „auf die Erde nieder“. Gegen diese Lösung spricht die Gewaltsamkeit der Abänderung, die übrigens nicht neu ist. Schon 1889 hatte R. Kögel diese radikale Lösung vorgeschlagen, ohne damit Anklang zu finden. Es liegt ihr die Vorstellung zugrunde, daß die idisi der ersten Vershälfte Schlachtjungfrauen seien, die sich aus den Lüften auf die Erde niederlassen. So sagt Kroes**: „Wir lesen im ersten Halbvers des Spruches, daß Schlachtjungfrauen sich niedersetzen.“ In Wirklichkeit aber steht dort nur, daß sich idisi niedersetzten. Krogmann und Kroes halten die Tilgung von h in hera für einen Vorteil, um mit era einen guten Stabreim zu idisi zu gewinnen. Dieser verstechnische Gesichtspunkt rechtfertigt jedoch den Eingriff in den überlieferten Wortlaut nicht, denn auch die anderen Verse zeigen mangelhafte Stabreime. Wie sazun : sazun ist in der nächsten Zeile hapt : heptidun unbefriedigend, und in der vierten Zeile erscheinen Endreime statt Alliterationen.
* W, Krocmann, Era duoder, Z. f. dt. Altertum 83, 1951, S. 122—125,
** W. J. Kross, Hera duoder, Germ.-Rom. Mschr,, N. F.3, 1953, 75—76.“
Das ist ein Auszug aus Gerhard Eis: Altdeutsche Zaubersprüche, S. 59. Hier geht es um ein Wort in den Merseburger Zaubersprüchen und wie man das übersetzt.
Falls jemand zufällig beabsichtigt, Altgermanistik zu studieren: So sieht das dann aus.
Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II)

Reliquiar mit Korallenast, Niederrhein, 2. Hälfte des 13. Jhs., 33 cm hoch. Die Fassung besteht aus vergoldetem Silber.
Gang út, nesso, mid nigun nessiklínon, út fana themo marge an that bên, fan themo bêne an that flêsg, út fan themo flêsgke an thia húd, út fan thera húd an thesa strála. Drohtin, uuerthe só! (Altsächsischer Wurmsegen, der älteste überlieferte deutsche Zauberspruch, ca. 900)
Ich bitte das Publikum, das zufällig eine Koralle zur Hand hat, um ein Experiment: Man nehme dieses Nesseltier, am besten tot, und trage es eine Weile in einer Hosentasche. Was zu beweisen ist: Man wird nicht mehr krank, und es passieren einem weniger Unglücke als vorher.
Wie? Das sei Unfug? Das müssen wir uns genauer ansehen: Magie wirkt nicht? Alles Aberglaube? Wenn ein Pfaffe ein güldenes Gerät mit einer aufgepflanzten Koralle und Knochensplittern vermutlich unbekannter Herkunft in die Höhe hält und der versammelten Gemeinde zeigt – was geschieht dann? Nichts? Oder doch? Kann man es auch lassen?
Wir wiederholen: „Orale Gesellschaften theoretisieren nicht, sie inszenieren.  Das Ritual ersetzt, ja ist geradezu ihre soziale Theorie.“ (Johannes Fried
Das Ritual ersetzt, ja ist geradezu ihre soziale Theorie.“ (Johannes Fried) Objekte wie Reliquien sind dingliche bzw. verdinglichte Zeichen der sozialen Hierarchien und der Rituale.
Das Reliquiar mit der Koralle ist mein Lieblingsstück im Essener Domschatz – eine Mischung aus urkomisch bis lächerlich und gleichzeitig so fremd wie ein Alien, so dass es einen neugierig macht. Was haben die sich damals dabei gedacht? Und wozu das alles?
Wikipedia sagt darüber: Korallen und Korallenäste, vornehmlich von roter Farbe, wurden schon in der Antike für Amulette verwendet. Sie galten als Schutz gegen Krankheiten, Blitzschlag und Misswuchs. Sie waren im alten Ägypten der Isis und in Rom der Venus heilig. Rosenkränze aus Korallen („Paternosterkrallen“) waren im Nachmittelalter sehr beliebt. Im italienischen Volksglauben schützen Korallen Kinder gegen Unheil. Daher findet man auch viele Darstellungen des Jesuskinds mit Korallenkette und Halsband mit Korallenast.
Ich besitze auch eine Koralle (vgl. Foto), die ich vom Schnorcheln in Belize mitgebracht hatte: Sie war bunt, verlor aber alsbald ihre Farbe, nachdem ich sie abgebrochen hatte. Ich hatte nicht daran gedacht, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Ich würde der Koralle auf meinem Bücherregal aber keine besonderen Kräfte zusprechen. Aber warum andere das tun und warum es im Katholizismus vor Magie offenbar nur so wimmelt, muss erklärt werden. Dann fragen wir noch ganz naiv als Bonus: Was unterscheidet ein Reliquiar von einem Talisman, einem Amulett oder Votivgaben?
Marcel Mauss schrieb 1950, eine Religion nenne die Überreste älterer Kulturen „magisch“. „Stehen zwei Zivilisationen in Kontakt miteinander, so wird die Magie gewöhnlich der schwächeren zugewiesen.“ Aufgeklärte Menschen nennen das Hantieren der Katholiken mit Reliquien magisch, und das Christentum schaut auf die „primitive“ Vielgötterei älterer Religionen herab. Allerdings übernimmt der Katholizismus vorsichtshalber dann doch den „Volksglauben“ (Mauss nennt Magie „Religion für den Hausgebrauch“). Die angebliche Wirkung der Koralle ist theologisch nicht abgesichert, aber man weiß ja nie, und es schadet auch nicht, wenn man daran glaubt.
Erste These: „Wir müssen die Magie als ein System apriorischer Induktionen ansehen, die unter dem Druck von Bedürfnissen von Gruppen von Indiviuen vollzogen werden.“ Ich halte diesen Satz von Mauss für ziemlich genial, impliziert er doch, dass es keine „individuelle“ Magie gibt, sondern dass Gegenstände oder Rituale nur dann „wirken“, wenn sich die Gruppe vorher darauf geeinigt hat, dass es so sei.
Mauss behauptet auch, dass es keinen religiösen Ritus gebe, der nicht seine Entsprechungen in der Magie hätte. Der Ritus sei eine Sprache; mündliche Riten nennt man Inkantation, auch ein Synonym für „Beschwörung“.
Die Reliquiare und die mit ihnen verbundenen Rituale „sprechen“ also, sie zeigen, wie die Gesellschaft beschaffen sei. Das ist im Kapitalismus nicht so oder nur in maginalisierter Form vorhanden. Im antiken Rom war die Gesellschaft „verschriftlicht“, aber viele Rituale blieben dennoch magisch, zum Beispiel bei der pompa funebris (vgl. Egon Flaig) oder bei den zahlreichen Schadenzaubereien.
Oben: Armreliquiar der Beatrix von Holte (Äbtissin von 1292 bis 1327), gestiftet um 1300. Höhe 72 cm. Holzkern, mit Silberblech beschlagen, vergoldetes Kupfer. Der Holzkern hat eine Öffnung, dahinter ist ein Hohlraum für die Oberarm-Reliquie. Im Türchen, das von der Hand gehalten wird, sind weitere Reliquien, angeblich Körperpartikel der Stiftspatrone Kosmas und Damian (vgl. Essener Domschatz I) und der Heiligen Barbara.
Unten auf der Tür der Öffnung ist ein Bild der Äbtissin sowie die lateinische Inschrift (übers.:) „Die Essener Äbtissin Beatrix von Holte ließ mich machen.“ Diese feudale Dame war tatkräftig und streitbar und hatte sogar eine Gegenäbtissin, mit der sie sich vor Gericht befehdete. Nachdem die Stiftskirche 1275 abgebrannt war, ließ sie den Komplex wiederaufbauen und sicherte sich den Zugriff auf die Essener Vogtei, die der Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg beanspruchte (steht bei Thomas Schilp, habe ich nicht gelesen).
„Auf dem Stifterbild steht die betende Äbtissin in prachtvoller, pelzgefütterter Kleidung mit Wimpel und Weihel unter einer Arkade.“ (Zit n. Sonja Hermann)
Zweite These: Die „Gesetze“ der Magie sind 1. Kontiguität, 2. Ähnlichkeit und 3. Kontrast. Das meint:
1. Dinge, die sich berühren sind oder bleiben eine Einheit – das Teil steht für das Ganze. Ein Fingernagel eines Heiligen ist so gut wie der ganze Kerl (pars pro toto).
2. Ähnliches bringt Ähnliches hervor: Similia similibus curentur oder attractio similum (womit gleichzeitig bewiesen wäre, das Homöopathie Magie ist, also Quatsch mit Soße und nicht besser als Alchemie). Dazu Mauss: „Die Alten, Griechen wie Römer, haben geglaubt, die Augenkrankheiten dadurch heilen zu können, dass sie das Sehvermögen einer Eidechse auf den Kranken übertrugen; die Eidechse wurde getötet und danach mit Steinen in Berührung gebracht, aus denen Amulette gemacht wurden.“
3. In der Magie werden Dinge in einer Gruppe gefasst, die jeweils das Gegenteil sind, aber aufeinander wirken. Wie Lichtenberg sagte: „Grade das Gegenteil tun ist auch eine Nachahmung…“
Als Fazit der drei Gesetze bei Mauss: „Ähnliches erzeugt Ähnliches, Ähnliches wirkt auf Ähnliches, Konträres wirkt auf Konträres, und diese Formeln unterscheiden sich voneinander nur in der Anordnung ihrer Elemente. Im ersten Fall denkt man zunächst an das Fehlen eines Zustandes; im zweiten zunächst an die Anwesenheit eines Zustandes; im dritten vor allem an das Vorliegen eines Zustandes, der demjenigen entgegengesetzt ist, den man zu erzeugen wünscht. Im einen Fall denkt man an die Abwesenheit des Regens, den es mittels eines Symbols zu realisieren gilt; im anderen Fall denkt man an den strömenden Regen, dem es mit dem Mittel eines Symbols Einhalt zu gebieten gilt; auch im dritten Fall denkt man an den Regen, den man dadurch zu bekämpfen hat, daß man mittels eines Symbols sein Gegenteil hervorruft.“
Auch bei Amuletten, Talismanen und anderen Dingen, denen magische Kräfte zugeschrieben werden, sind diese drei Gesetze in Kraft. Vermutete Eigenschaften eines Objekt werden im kollektiven Denken auf andere Objekte übertragen, die entweder ein Teil des verehrten Ganzen sind, dessen man nicht mehr habhaft werden kann, oder dem ähnlich sind und/oder es berührt haben (wie in vielen Reliquiaren die angeblichen Nägel vom Kreuz Christi), oder das Gegenteil, mit dem man zum Beispiel etwas abwehren will.
Die Reliquiare wirken magisch, weil der Glaube, dass diese irgendwie wirkten, einen intellektuellen „Mangel“ überbrückt – man kann die Gesellschaft und ihre Hierarchien nicht im heutigen Sinn rational begreifen. Die Individuen eignen sich durch die Reliquien und die mit ihnen untrennbar verbundenen Rituale kollektive Kräfte an.

Armreliquiar mit Reliquien des Heiligen Basilius, 2. Hälfte des 11. Jhs., Höhe 47 cm. Die Standplatte ist aus Blech und mit Scharnieren am Holzkern befestig. Die „Hand“ lässt sich öffnen. Das Reliquiar stilisiert die liturgische Dalmatik der Bischöfe. Die Zierborte wurde graviert. Die Oberfläche des „Handschuhs“ zeigt eine Art Fischgrätmuster. Auf dem Handrücken ist ein Medaillion (das ich zu fotografieren vergessen habe) mit der lateinischen Aufschrift (übers.:) „Heiliger Basilius, Diener des lebendigen Gottes, segne uns“ und „Die Rechte Gottes“.
Im Liber Ordinarius der Essener Stiftskirche wird beschrieben, welche Rolle das Armreliquiar spielte: Die „Hand“ wurde in eine Kirche nach Stoppenberg getragen und dort auf dem Altar präsentiert; eine Woche später wieder zurück. Unter Gesängen schlug der Priester dann ein Kreuz mit dem Reliquiar über die Anwesenden. [Es gibt ein Examplar eines Liber Ordinarius aus dem Jahr 1908 online – wer extrem komplizierte Rituale gern schriftlich mag.]
Seit dem 5. Jahrhundert sind Reliquiare in Form von Körperteilen mündlich überliefert, seit dem 11. Jh. als Objekt. Aus dieser Zeit sind insgesamt nur fünf Armreliquiare erhalten. Das aus dem Essener Domschatz ist also exotisch und extrem selten.
In der Schatzkammer der Kirche St. Ludgerus in Werden ist sogar noch ein erhaltenes Original eines solchen Handschuhs zu sehen. [Merke II: Obwohl Werden heute ein Stadtteil Essens ist, war das dortige karolingische Reichskloster fränkisch, der Dom in Essen aber lag schon in Sachsen.]

Armreliquiar des hl. Quintinus, nach 1491. Gestiftet von Margarete von Castell, Pröpstin des Stifts Essen. Das Exemplar ist insofern interessant, als es rund 200 Jahre jünger als die anderen Arm- und Handreliquiare ist. Das Prinzip bleibt, aber handwerklich ist es aufwändiger gearbeitet – gegossene Statuetten von Engeln, vergoldeter Brokat“stoff“, sogar Adern sind an der Hand zu erkennen. Hinter dem Fenster im Arm sind die Reliquien. Das Wappen der Stifterin ist verlorengegangen. In den Fingerspitzen sind stilisierte Nägel zu sehen, die an die Folter des Quintinus erinnern sollen: Dieser wurde angeblich im 3. Jh. zur Zeit der Kaiser Diokletian und Maximian in Gallien mit Nägeln traktiert, umgebracht und in die Somme geworfen.
Fortsetzung folgt.
* Soziologie und Anthropologie: Band 1: Theorie der Magie / Soziale Morphologie, vgl. auch Rezeption Mauss‘ in Deutschland]
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I)
Karolingisches Schwert aus dem Essener Domschatz, hergestellt vor 1000. Die Schwertscheide hat einen Holzkern und ist mit getriebenen Goldplatten bedeckt. Der Griff ist mit Edelsteinen und Emails verziert. Länge: knapp einen Meter. Auf der Scheide sind Ranken aus sorgfältig verteilten Blättern mit fantastischen Formen vermutlich byzantinischen Ursprungs. Die Scheide ist vermutlich ein Geschenk Kaiser Otto III. an das Essener Stift.
Es ist wie mit Frauen, dem Universum und dem Mikroskop vielen Dingen: Je genauer man hinschaut, um so interessanter kann es werden. Das gilt auch für „Prunkschwerter“. Wie der Name schon sagt: Sie sind nicht zum Kämpfen, sondern zum protzen Prunken, was aber im Feudalismus etwas anders heißt als im heutigen Kapitalismus. In jenem haben wir das Problem, dass es außer der Archäologie kaum etwas gibt, das als Quelle taugt. Vor und nach der karolingischen Renaissance muss man sich an Objekte halten, meistens der religiösen Art.
Wir hatten hier schon Marcel Mauss zitiert: „Nicht seelische Regungen oder psychische Prozesse sollten jeweils sichtbar gemacht werden, sondern objektivierende Formen sozialer Ordnung und Interaktionen. (…) Prestige und Status waren im Auftreten sichbar zu machen; nur ritualisiert ließen sie sich wahrnehmen, Herrschaftszeichen, Gaben, Kleider, Gebärden machten Leute.“ (Vgl. Die Gabe: Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften). Ich wiederhole mich: Wer begreift, was eine Reliquie ist (vergesst den oberflächlichen Unsinn auf Wikipedia), ist auf dem richtigen Weg.
Das Essener Schwert, heute Teil des Stadtwappens, ist nicht als Bodenfund erhalten geblieben, sondern als Teil des Domschatzes. Das ist selten. Es war rund 20 Jahre „in Gebrauch“; jemand hat damit gekämpft. Das haben metallurgische Untersuchungen gezeigt. Das Damaszener-Schwert wurde auch oft geschliffen und dadurch rund sechs Millimeter schmaler als ursprünglich. Das Essener Schwert ist von so hoher Qualität, dass es vermutlich für einen Königshof in Auftrag gegeben wurde.
Als Teil des Kirchenschatzes wurde es seiner „militärischen“ Qualitäten verlustig. Man nahm den ursprünglichen Griff aus Holz oder Horn und die Parierstange ab, heftete die Kostbarkeiten daran und fertigte die Scheide (die Klinge ist in der Ausstellung gar nicht zu sehen, das wird nicht allen auffallen). Das Wichtigste ist die Inschrift, die vermutlich erst im 15. Jahrhundert hinzugefügt wurde:
Gladius cu(m) quo fueru(n)t / decollatia) / p(at)ronib) / n(ost)ri
Das Schwert, mit dem unsere Patrone enthauptet wurden.
Somit hat sich ein gutes Schwert in eine Reliquie verwandelt. Man verbindet die legendären frühchristlichen Zwillingsbrüder Kosmas und Damian, die vielleicht zur Zeit des römischen Kaisers Diokletian lebten, mit dem Schwert, dazu kommen seltene, exotische und kostbare Schmuckstücke, alles kombiniert mit bestimmen Ritualen, und fertig ist die objektivierende Form sozialer Ordnung und Interaktion. Noch im 18. Jahrhundert wurde das Schwert während der Fronleichnamsprozession herumgetragen und dem gemeinen Volk vorgeführt, dass es nur so prunkte.
Wir müssen leider die Abstraktionsschraube noch ein wenig mehr anziehen. Ich hatte mich natürlich auf den Besuch des Domschatzes vorbereitet und u.a. Gold vor Schwarz: Der Essener Domschatz auf Zollverein gelesen, ein gutes, ausführliches und vor allem bezahlbares Buch zum Thema. Über das, was mich interessiert, findet man natürlich dort nichts. Über die bloße Phänotypie kommt die bürgerliche Historiografie nur selten hinaus. (Der hier schon oft zitierte Johannes Fried Johannes Fried ist eine große und um so bemerkenswertere Ausnahme.)
Was braucht es, um einen Gebrauchsgegenstand in eine Reliquie zu verwandeln? Klobürsten oder banale Dinge sind nur dann ungeeignet, wenn sie keinen Bezug zum jeweils passenden Überbau, also der Religion, haben. Ich habe auch in Essen zahlreiche Nägel gesehen, die verehrt wurden, weil sie angeblich vom Kreuz stammten, an dem angeblich der Sohn des christlichen Gottes starb. Fazit: Jedes Objekt ist theoretisch geeignet. Reliquien sind auch nicht auf das Christentum beschränkt. Wir müssen uns also auch in das luftige Reich der Magie begeben, also hinsehen, wie in einer oralen Gesellschaft das Volk im Sinne des Wortes verzaubert wird.
Fortsetzung folgt.
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
– Pantokrator in der Mandorla, Frauen, die ihm huldigen und die Villikation (Essener Domschatz V) (23.12.21)
– Jenseits des Oxus (09.01.2022)
– Blut, Nägel und geküsste Tafeln, schmuckschließend (Essener Domschatz VI) (18.04.2022)
– Missing Link oder: Franziska und kleine Könige (28.05.2022)
– Die Riesen von Gobero (Die Kinder des Prometheus Teil I) (18.07.2022)
– Die Liebhaber von Sumpa, Ackergäule und Verhüttung (Die Kinder des Prometheus Teil II) (25.07.2022)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)
Monasterio sanctimonialium quod Astnidhi appellatur
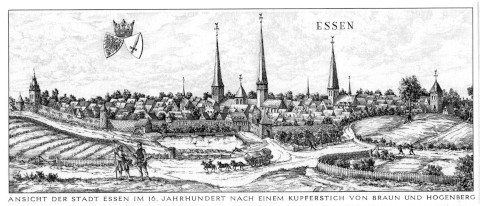
Essen im 16. Jahrhundert, nach einem Kupferstich von Braun und Hogenberg
Seit dem 13. Jahrhundert ruhte das seltsame Stück Schlauch, von höchster Instanz der katholischen Kirche als Sinnbild christlicher Keuschheit und Zeugnis erstaunlicher sizilianischer Mannbarkeit bestätigt, in einem kunstvoll ziselierten und mit Seide ausgekleideten Silberschrein, der nur alle hundert Jahre zur Feier des Centenariums von Sta. Felicita geöffnet und zur Schau gestellt wurde, damit jedermann das wundersam der Verwesung entzogene Glied des Heiligen in Augenschein nehmen könne. (Wolfgang Jeschke: Der letzte Tag der Schöpfung.)
Wer sich für zukünftige Welten interessiert, denkt bei „Reliquie“ natürlich zuerst an das obige Zitat, „das Unaussprechliche des Heiligen Veit“, das sich später als etwas anderes entpuppt. Versuche ich mit Freunden über meinen jüngsten Besuch im Essener Dom zu reden, muss ich – zu Recht! – erklären, was das soll und wozu man das braucht. Ich möchte das Publikum daher, bevor wie in einem weiteren Teil zum Allerschatzmäßigen kommen, mental darauf einstimmen, inwiefern Reliquien ein Baustein zu dem schon lange geplanten Einen und Einzigen Wahren und Autorativen, Historisch Genauen und Amtlich Anerkannten Bericht über den Feudalismus gehören und wie er den Kapitalismus gebar und warum und warum anderswo nicht – der geplante Beitrag soll allem Widerspruch und Streit zum Thema ein Ende setzen.
Der Dom in Essen ist gedrungen und unscheinbar und liegt inmitten der extrem hässlichen und langweiligen Innenstadt, die man getrost komplett abreißen könnte, ohne dass jemand auch nur eine Träne vergösse. Früher besaß Essen, wie fast alle deutsche Städte, einen mittelalterlichen Stadtkern, dazu Straßenzüge mit der typischen Architektur der Gründerzeit. Dann meinten die Deutschen, Hitler an die Macht bringen zu müssen, mit der bekannten Folge, dass alles kaputt ging. Man muss sich also auch wundern, dass es Dinge, die aus der Karolingerzeit stammen, also mehr als ein Jahrtausend alt sind, überhaupt noch gibt.

Das Kruzifix im Atrium des Doms ist um 1400 entstanden, also rund 50 Jahre vor Erfindung des Buchdrucks
Das Ruhrgebiet ist schon seit der Jungsteinzeit besiedelt. Die Franken hatten in Essen eine Burg übernommen oder bauen lassen. Interessant ist die karolingischen Zeit, also das neunte und zehnte Jahrhundert, deswegen, weil das Ruhrgebiet zum sogenannten Stammesherzogtum Sachsen gehörte, womit eine tribalistisch organisierte Gruppe Warlords gemeint ist. Das Frauenstift in Essen wurde um 840 vom sächsischen Feudalherrn und späteren Bischof Altfrid gegründet. Kaiser Karl war Franke, seine ottonischen Nachfolger Sachsen wie auch die Äbtissinen des Stiftes.

Reliquienbehälter aus Blei, Ende 10. Jh. bis ca. um 1300, einige sind jünger. Diese Kästchen wurden in die Altäre eingemauert, in die so genannten Sepulcren der Altarmensen. In einigen Behältern sind immer noch Reliquien: Knochenpartikel, mit Leinen umwickelt samt Zettelchen mit den Namen der Heiligen. In einem war eine Glasampulle, die angeblich Wasser des Jordan enthielt.
Das wirkt bis in die Architektur: Der spätere Dom auf den Fundamenten der ottonischen Kirche ist nicht, wie etwa der Kölner Dom, gotisch, setzt also nicht auf Höhe und spitze Bögen, sondern romanisch, ist also gedrungener und hat runde Bögen. Das musste damals „altertümelnd“ wirken und war vermutlich ein bewusster architektonischer Affront gegen die „Moderne“ oder auch ein kulturelles Statement des „Sächsischen“ gegen das „Fränkische“.


Oben: Evangelist (Fragment), getriebene geschmiedete Messingplatte, 2. Hälfte 10. Jahrhundert, im Original 24,8 x 9 cm. Unten: Himmelfahrt Christi (Fragment), dito, im Original 23 x 11,8 cm.
Man könnte dazu noch viel mehr sagen, vor allem über die Macht der Frauen Äbtissinnen im Feudalismus, die in Essen dem Papst direkt unterstanden. Ich hatte mir eine private Führung durch äußerst kundigen Rainer Teuber gegönnt, mit dem ich höchst erbaulich diskutieren konnte. Das Publikum aber würde vermutlich laut lamentierend fliehen und wegzappen.

Türzieher, Mitte 13. Jh, gegossene ziselierte Bronze
____________________________________
Bisher zum Thema Feudalismus erschienen:
– Reaktionäre Schichttorte (31.01.2015) – über die scheinbare Natur und die Klasse
– Feudal oder nicht feudal? tl;dr, (05.05.2019) – über den Begriff Feudalismus (Fotos: Quedlinburg)
– Helidos, ubar hringa, do sie to dero hiltiu ritun (08.05.2019) – über die Funktion der verdinglichten Herrschaft in oralen Gesellschaften (Quedlinburger Domschatz I)
– Tria eburnea scrinia com reiquis sanctorum (09.05.2019) – über Gewalt und Konsum der herrschenden Feudalklasse als erkenntnistheoretische Schranke (Quedlinburger Domschatz II)
– Die wâren steine tiure lâgen drûf tunkel unde lieht (10.05.2019) – über die Entwicklung des Feudalismus in Deutschland und Polen (Quedlinburger Domschatz III)
– Authentische Heinrichsfeiern (13.05.2019) – über die nationalsozialistische Märchenstunde zum Feudalismus (in Quedlinburg)
– Der Zwang zum Hauen und Stechen oder: Seigneural Privileges (15.06.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [I] (24.07.2019)
– Yasuke, Daimos und Samurai [II] (03.05.2020)
– Agrarisch und revolutionär (I) (21.02.2021)
– Trierer Apokalypse und der blassrose Satan (17.03.2021)
– Energie, Masse und Kraft (04.04.2021)
– Agrarisch und revolutionär II (15.05.2021)
– Gladius cum quo fuerunt decollati patroni nostri (Essener Domschatz I) (28.10.2021)
– Magische koloniebildende Nesseltiere mit kappadokischem Arm und Hand (Essener Domschatz II) (14.11.2021)
– Ida, Otto, Mathilde und Theophanu, kreuzweise (Essener Domschatz III) (27.11.2021)
– Hypapante, Pelikane und Siebenschläfer (Essener Domschatz IV) (17.12.2021)
Zum Thema Sklavenhaltergesellschaft:
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil I]) 05.11.2020)
Doppeldenk oder: Die politische Macht kommt aus den Legionen [Teil II]) 27.12.2020)