Der Stoff, aus dem die Träume sind
(aus meinem Buch Heroin – Sucht ohne Ausweg?“ (1993)
Das «Rauschgift» Opium in der Apotheke? Damit gab es im 19. Jahrhundert keine Probleme. Niemand wußte jedoch, welche Substanz des Mohnsaftes die eigentliche Wirkung ausmachte. Das hatte manchmal fatale Folgen, denn eine exakte Dosierung war unmöglich, das Medikament konnte tödlich wirken.
Heute ist die Situation ähnlich, aber aus völlig anderen Gründen. In jeder Apotheke steht eine Flasche Opiumtinktur herum. Aber kaum ein Arzt traut sich, das Präparat zu verschreiben. Die Mediziner könnten sich informieren, tun es aber in der Regel nicht – aus Angst vor den strengen Auflagen des Betäubungsmittelgesetzes. Während in England ausführliche Forschungen zur pharmakologischen Wirkung der Opiate vorliegen, sind die deutschen Ärzte meistens schon bei simplen Fragen zum Thema völlig überfordert.
Dementsprechend «sachkundig» verlaufen auch die öffentlichen Diskussionen über Drogen, von der Kompetenz der Politiker und «Drogenbeauftragten» ganz zu schweigen. Dabei hat die Beschäftigung mit Papaver somniferum gerade hierzulande eine lange Tradition: Morphium und Heroin sind Erfindungen deutscher Apotheker und Firmen.
Natürlich wußte man im 19. Jahrhundert aus Erfahrung, daß Opium nicht nur alle möglichen Krankheiten kuriert, sondern daß man sich damit auch umbringen kann.
In Hessen war, schreibt Hans-Georg Behr, die «Frankfurter Hauptpille» auf dem Markt, ein Gemisch aus Opium und Zucker. Opiumhaltige Medikamente wie «Dr. Zohrers Kinderglück» und «Aachener Schlafhonig» wurden auch Babys zur Beruhigung und zum besseren Schlaf verordnet. Einige der kranken Kinder wachten jedoch nach der Einnahme des «Kinderglücks» nicht mehr auf. Der Arzt Dr. Heinrich Hoffmann sah sich angesichts der Todesfälle veranlaßt, nach einem unschädlicheren Ersatzpräparat zu suchen. Die von ihm entwickelten «Hoffmannstropfen» enthielten aber immer noch fünf Prozent Opium.
In England hieß das beliebteste einschlägige Mittel «Godfrey’s Cordial». «Die erste Untersuchung von Opiatvergiftungen an Kindern wurde 1843 in einer kleinen Stadt in Lancashire vorgenommen», schreibt Hans-Georg Behr. «Von knapp 2500 Familien kauften mehr als 1600 regelmäßig Godfrey’s Cordial. Die Kindersterblichkeit lag über 60 Prozent, und ein abruptes Absetzen der Droge überlebte nur jedes sechste Kind.»
Verschiedene Forscher experimentierten daher mit der Rohsubstanz Opium, um dessen unerwünschten Elemente zu beseitigen, die, wie vermutet wurde, zu den Nebenwirkungen führten. Das chemische Element Stickstoff, dessen Verbindungen – die Alkaloide – in Pflanzen vorkommen und das des Rätsels Lösung gewesen wäre, war noch nicht bekannt.
Im Jahr 1805 bekam eine Leipziger Zeitschrift, das Trommsdorffer «Journal der Pharmacie», merkwürdige Post. Der Paderborner Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner bot einen Artikel an, in dem er behauptete, er habe das «schlafmachende Prinzip des Opiums» entdeckt. Die Herausgeber des «Journals» überflogen den Bericht, schüttelten bedenklich ihre Köpfe, überdachten die Reputation ihres Blattes und lehnten dann Sertür-ners Ausführungen ab, da sie unseriös seien. Der Apotheker ließ nicht locker. Er schrieb einen Leserbrief, in dem er seine Experimente schilderte. Der wurde gedruckt, aber niemand beachtete ihn.
Dabei war der zwanzigjährige Pharmakologe auf dem besten Weg, der berühmteste Sohn der Stadt Paderborn zu werden, bekannter noch als der zu seiner Zeit in der Domstadt residierende Bischof. Sertürners Versuchsanordnung: Man laugt Opium mit destilliertem Wasser aus, bis alle Farbstoffe ausgeschieden sind. Die eingedampfte Lösung wird, wieder mit Wasser, verdünnt, dann mit Ammoniak übersättigt. Flüssiges Ammoniak war schon damals als gutes Lösungsmittel bekannt. Bei diesem Prozeß entsteht eine Substanz, die noch in vielen Hausapotheken als Salmiakgeist zu finden ist.
Spannend wurde es, als sich – als Resultat des Experiments kleine Kristalle bildeten, die irgend etwas mit der Wirkung des Opiums zu tun haben mußten. Sertürner verfütterte sie an einen bedauernswerten Hund, der zufällig an seiner Tür herumschnüffelte. «Nach Zufuhr des Stoffes stellten sich alsbald Schlaf und später Erbrechen ein. Bei erneuter Aufnahme wurde alles erbrochen; doch die Neigung zum Schlafe hielt mehrere Stunden an.» Somit war klar: Wenn die Kristalle die gleichen Symptome wie Opium hervorrufen, sind sie die eigentliche Grundsubstanz. Ein zweiter Tierversuch endete sogar tödlich, das Tier «taumelt schlafsüchtig und stirbt schließlich».
Sertürner, bewandert in griechischer Mythologie, nennt den von ihm entdeckten Stoff nach Morpheus, dem Gott der Träume, Morphium. Neugierig, wie er ist, probiert er ihn selbst aus, zusammen mit drei jugendlichen Freunden. Zunächst beobachtet er Übelkeit und einen betäubenden Schmerz im Kopf, dann, nachdem die Versuchspersonen die Dosis erhöhen – sie nehmen das Pulver zusammen mit Wasser und Alkohol ein -, «Ermattung und starke an Ohnmacht gränzende Betäubung». Sertürner glaubt an eine Vergiftung, schreibt er 1817 in den «Annalen der Physik», die in ihm eine «solche Besorgniß» auslöst, daß «ich halb bewußtlos über eine Viertelbouteille starken Essig zu mir nahm, und auch die übrigen dies thun ließ. Hiernach erfolgte ein so heftiges Erbrechen, daß einige Stunden darauf einer von äußerst zarter Constitution, dessen Magen bereits ausgeleert war, sich fortdauernd in einem höchst schmerzhaften, sehr bedenklichen Würgen befand».
1817 wird das Morphin in ein Arzneibuch eingetragen. Erst nach einer Würdigung durch den französischen Physiker Louis-Joseph Gay-Lussac erringt der junge Apotheker Anerkennung, die sich aber in Deutschland in Grenzen hält. Der neue Forschungszweig, zu dem er die Tür weit aufgestoßen hat – die Alkaloidchemie -, zeigt erst viel später seine Früchte.
1826 beginnt der Apotheker Emanuel Merck im Laboratorium der Engel-Apotheke in Darmstadt mit der kommerziellen Herstellung des Morphiums als Schmerz- und Schlafmittel. Es ist bekannt, daß Morphin euphorisierend wirkt. Die Mediziner und Forscher diskutieren aber mehr darüber, wie sich die Nebenwirkung der oralen Einnahme – der obligatorische Brechreiz – vermeiden läßt. Man sucht eine Möglichkeit, den Weg durch den Magen zu umgehen.
Morphium wird, um eine Überdosierung zu vermeiden, auch als Salbe oder Öl verschrieben. Damit das Medikament schneller und intensiver wirken kann, empfehlen einige Mediziner das Katharindenpflaster, das eine Hautblase erzeugt. Die schützende Haut ist somit «ausgetrickst»: Auf die verdünnte Stelle, die Blase, kann die morphiumhaltige Salbe oder das Puder aufgetragen werden.
Die «hypodermatische Inokulation» kommt dem Spritzen schon ein wenig näher: Mit einer Nadel schiebt der Arzt kleine Mengen des Medikaments unter die Haut. Als Charles Gabriel Pravaz 1853 die Injektionsspritze erfindet – sein Kollege Alexander Wood hat zwei Jahre später die gleiche Idee -, nimmt die Sache ihren Lauf. Ein Badearzt in Schlangenbad spritzt einer Frau, die an «hysterischen Krämpfen» leidet, Morphium unter die Bauchdecke – mit dem Erfolg, daß ihre Beschwerden schlagartig verschwinden.
Das spricht sich herum. In wenigen Jahrzehnten entwickelt sich Morphium – heute: Morphin – zum Heilmittel für alles und jedes: gegen Husten und Schmerzen, gegen Schnupfen, Krämpfe und Augenleiden. Wer sich nur glücklich fühlt, gilt als geheilt. Im Krimkrieg, in den Kriegen zwischen Preußen und Dänemark bzw. Österreich, im deutsch-französischen Krieg, im amerikanischen Bürgerkrieg: Überall wird Morphin gespritzt, was das Zeug hält.
Nur gibt es eine neue, ebenfalls unerwünschte Wirkung des Wundermittels: Wenn man es dem Patienten plötzlich vorenthält, läuft er Amok oder verfällt in tiefe Depressionen – was die Kampfmoral nicht gerade hebt. Militärärzte nennen die Symptome des Morphin-Entzuges die «Armee-» oder «Soldatenkrankheit».
Wer oder was an den Problemen der Morphin-Konsumenten schuld ist, bleibt unklar. Patienten, die an eine bestimmte Dosis gewöhnt sind, neigen zur Selbstmedikation und – das wird beobachtet – zur Dosissteigerung. Ärzte konstatieren eine «Zerrüttung des Nervensystems» – obwohl niemand genau weiß, inwieweit «die Nerven» von Morphin in Mitleidenschaft gezogen werden – und «schwere psychische Störungen» – Ursache oder Folge des vermehrten Konsums oder nur des zeitweiligen Absetzens? Auch das ist nicht erforscht. 1874 erklärt der erste Arzt den überhöhten
Morphingebrauch zur Krankheit sui generis.
Schon 1856 vermutet die Polizei, die staatliche Ordnung im allgemeinen und besonderen sei durch den Drogenmissbrauch in Gefahr. Der Polizeipräsident von Berlin erläßt eine Verfügung, daß Ärzte Morphium nur wiederholt abgeben dürften, wenn darüber ein schriftlicher Vermerk angefertigt würde. Von «Drogensucht» ist aber noch nicht die Rede.
Der Berliner Arzt Eduard Levinstein ist der erste, der die Begriffe «Sucht» und Morphium verklammert. In einer 1880 erschienenen Monographie unterscheidet er zwischen dem «Morphinismus», der eine Vergiftung sei, und der «Morphinsucht». Er versteht darunter die «Leidenschaft des Individuums, sich des Morphiums als Erregungs- oder Genußmittels zu bedienen, da dasselbe unvermögend ist, von dem Mittel ohne Nachtheil für das subjektive Wohlbefinden zu lassen, und den Krankheitszustand, der sich durch die mißbräuchliche Anwendung des Mittels herausbildet». Männer seien für die «Sucht» anfälliger, da sie im Berufsleben höheren Anforderungen genügen müßten. Morphinsüchtig seien fast ausschließlich Ärzte und Offiziere.
Bereits fünf Jahre zuvor hatte Levinstein über die Morphiumbegeisterung gewisser Kreise berichtet. In der «Berliner Klinischen Wochenschrift» vom 29.11.1875 heißt es dazu: «Aus der ersten Sitzung der inneren Medizin erfahren wir, daß das so alt bewährte Mittel, die Sorgen des Daseins in die Freuden elyseischer Träume zu verwandeln, bei uns von einer Mode bedroht zu werden anfängt, die diesmal nicht von Westen, sondern ausnahmsweise einmal von Osten ihren Einzug hält. Bisher schien es ein erprobtes Vorrecht des Muselmannes zu sein, sich mit Hilfe des Opiums hinüber zu schwingen in das Reich ungetrübter Genüsse. Glieder unserer gebildeten und höheren Stände, theilt uns Herr Sanitätsrath Dr. Levinstein mit, beginnen indes im Anschluß an den medicamentösen Genuß des Narcoticums ebenfalls des vom Koran verpönten Saftes der Rebe überdrüssig zu werden. Auch sie ziehen es vor, ihr Dasein mit Opium zu würzen, das sie zwar nicht wie der Türke mit gekrümmten Beinen dem Tschibuk entnehmen, aber ihrer höheren Kultur entsprechend gleich als reines Alkaloid sich mit oder ohne Zuhilfenahme der Pravazschen Spritze einflößen. Den antiquierten Alkoholrausch überlassen sie dem ‘gemeinen’ Mann, müssen aber mit ihm gewisse Folgen theilen, die dem Alhoholismus nicht ganz unähnlich sind, und von denen leider auch die Morphiumfreunde nicht verschont bleiben.»
Die Zeitschrift bedient sich einer feinen Ironie, die zu wütenden Protesten aufgeregter Drogenpolitiker wegen «Verharmlosung» führen würde, übertrüge man die Aussagen auf heutige Verhältnisse: Die Heroin«freunde» wollen von der etablierten Saufkultur nichts wissen. Sie ziehen es vor, sich mit dem «alt bewährten» Opium zu berauschen. «Ihrer höheren Kultur entsprechend» essen oder rauchen sie es aber nicht – wie viele der «ausländischen Drogendealer» -, sondern injizieren sich das mit modernen chemischen Methoden hergestellte Derivat Heroin. Bedauerlicherweise» leiden auch sie, wie Alkoholiker, an unangenehmen Entzugssymptomen.
Morphin, so zeigt der Bericht Levinsteins, war – nicht als Medikament, sondern als Genussmittel – zunächst eine Modedroge der «besseren Kreise». Eine bestimmte Form des Gebrauchs, die Injektion, setzte die Konsumenten sozial von anderen. Drogenkonsumenten ab: Die intravenöse Applikation war ein Zeichen «höherer Kultur».
Heute gilt das Gegenteil: Wer Drogen spritzt, fällt unter die – abwertend verstandenen – Kategorien «Fixer» oder «Junkie» und muß mit den klischeehaften Vorverurteilungen wie «unzuverlässig», «heruntergekommen» und «kriminell» rechnen. Alkoholiker, die ihr Rauschmittel oral einnehmen und sogar in deutschen Parlamenten zu finden sind, gelten dagegen, solange sie nur ihren eigenen Körper ruinieren, als sozial unschädlich.
Alle Formen, die heute diskutiert werden, um Morphinabhängige zu behandeln, waren schon im vergangenen Jahrhundert bekannt. Ärzte schlugen den «kalten Entzug» vor, das abrupte Absetzen, was eine knappe Woche dauerte. Andere empfahlen, während des Entzugs Haschisch oder Marihuana zu rauchen. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud propagierte Kokain: «Freud selbst hatte Kokain seinem Freund Fleischl von Marxow verabreicht, der nach einer Daumenamputation morphinabhängig geworden war.» Beliebt war auch die Substitution durch Codein, die in den neunziger Jahren zum therapeutischen Standard gehörte.
Kommentare
4 Kommentare zu “Der Stoff, aus dem die Träume sind”
Schreibe einen Kommentar


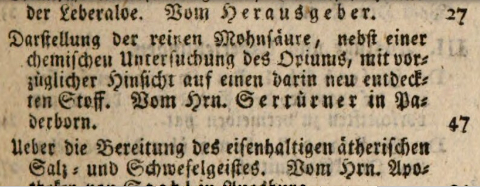

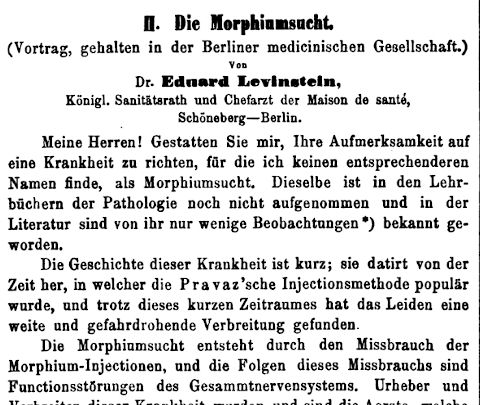



















… sehr gut! Es liest sich wie eine wissenschaftliche Arbeit.
Gruß
Jens
Morphiumsucht kam auch in Pre-Code-Filmen vor, so z.B. in Heroes For Sale:
„During Tom’s captivity, German doctors treat his pain with morphine and he becomes addicted to the drug. After Tom returns from the war, Roger offers him a job at his father’s bank out of shame.
But Tom’s addiction costs him his job. Exposed as an addict, confined and cured in an asylum, he comes out in 1922, unemployed and alone; his mother has died, apparently of shame and grief, while he was away.“
https://en.wikipedia.org/wiki/Heroes_for_Sale_(film)
Auch an Opiumhöhlen konnte Hollywood damals nicht vorbeigehen, so sieht man eine z.B. im Film The Mask of Fu-Manchu. Den Film würde man heutztage garantiert nicht mehr so filmen dürfen, das Gekreische der woken Brigade wäre immens. Ich finde den Film hingegen sehenswert, es spielt auch Myrna Loy mit, welche damals sehr oft Asiatinnen spielen musste, und die Auspeitschszene ist auch interessant…faster, faster!
Da fliegt mir doch das Blech weg.
Tolle Recherche, die Monografie aus 1883 liest sich gut, besser als die heutigen Veröffentlichungen.