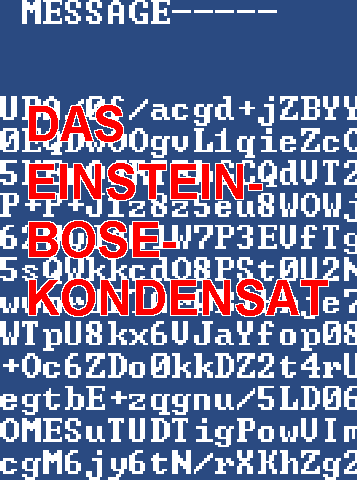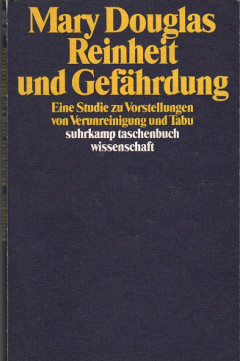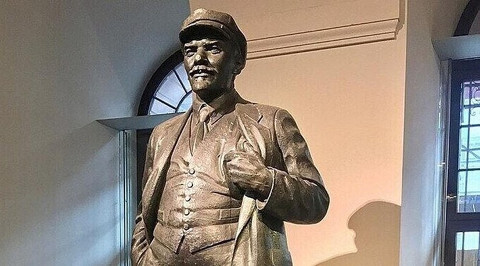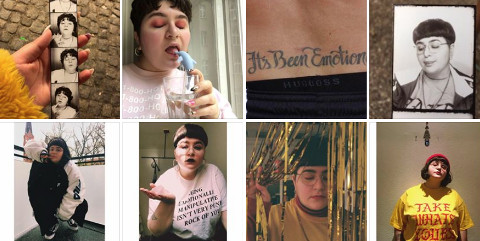Ich habe noch ein paar Fotos aus Bolivien gefunden und diese in pingeliger Fummelei digitalisiert und restauriert. Ich fasse jetzt meinen „Trip“ von Oruro über Huachacalla nach Chipaya in einem Posting zusammen. Diese „Expedition“ dauerte mehr als eine Woche (April 1984) und war mit das interessanteste und anstrengendste Abenteuer, das ich in mehr als zwei Jahren in Lateinamerika erlebt habe – drei Tage mit dem LKW und anschließend 40 Kilometer zu Fuß, mit Rucksack, und nach drei Tagen wieder zurück. (Vgl. auch „In der Salzwüste – Un poco mas atletismo“ (08.04.2013), „Uru – Chipaya“ (03.07.2015) und „Huachacalla – Durch die Wüste“ (25.03.2018 – dort muss ich noch einige Ortsangaben korrigieren).
Wir starteten von Oruro aus (auf dem oberen Bild bin ich mit Rucksack zu sehen) zum Puente Chusakeri (Foto unten). Da standen damals nur einige Häuser. Der Bus von Oruro hatte uns mitten in der Pampa abgesetzt, und wir mussten das Flussbett, wo der Truck angeblich losfuhr, selbst finden – man trottet in einem solchen Fall den anderen Reisenden hinterher.

Aus meinem Reisetagebuch, Ende April 1984:
Der LKW ist so voll, dass selbst die Leute bei unserem Einsteigen schon no hay campo! [es ist kein Platz mehr!] schrieen. Aber bei dem Gerüttele auf der Piste, die ihren Namen gar nicht verdiente, wurden alle Passagiere samt Gepäck so durchgemischt, dass letztlich für alle ein Fußbreit übrig blieb.
In der Abenddämmerung düsen wir los. Bei Flussdurchquerungen müssen die Männer aussteigen und den Weg für den LKW präparieren. (Die Ruta Nacional 12, die man heute erkennen kann, existierte damals noch nicht.)

Spät in der Nacht kommt ein riesiges Flussbett (der Fluss, vom dem man uns vorher erzählte, dass er einen Bulldozer, einen Jeep und diverse LKWs verschlungen habe). Dort müssen alle zu Fuß hindurchlaufen. Wir beide probieren zuerst, ohne die Schuhe auszuziehen, einen Weg zu finden. Das Flussbett ist aber so schlammig, dass man bis zu den Knöcheln einsinkt – mitten in der Nacht ziemlich unheimlich. Die anderen pasajeros kann man kaum erkennen. Am Ufer auf der gegenüberliegenden Seite zünden sie mit B.s Feuerzeug das Pampagras an, damit der LKW weiß, wo er hin muss.
In Opoqueri müssen wir in dem örtlichen Kramladen einen Platz zum Schlafen suchen. Die Nacht ist eiskalt und sternenklar. Am Morgen stehen alle zitternd herum und rufen [nach dem Fahrer]: Vamos, maistro!. Einige sammeln Brennmaterial und kochen Kaffee. Sogar ein Stück knochentrockenes pan fällt für uns ab.


Ein kurzes Stück nach Opoqueri kommt ein cortes [vermutlich „Einschnitt“], wo schon ein LKW im Schlamm steckt. Als der raus ist, fährt unser hinein, und zwar so tief, dass das Hinterrad vollständig verschwindet.
Mit Holzlatten und Gasflaschen bauen sie eine Art Hebel, und Zentimeter für Zentimeter werden Sand, Steine und Zweige unter die Räder gestopft. [Bäume gibt es in der Salzwüste nicht.] Zum allgemeinen Erstaunen tritt meine Taschenmessersäge in Aktion, um den durchfeuchteten Hebebaum zu kürzen.
Die Kerle betrachten die Angelegenheit mehr rituell: Es wird endlos gelabert und die Sache unnötig verkompliziert. Weil sie wohl Angst haben, dass es wieder schief geht, zögern sie einen erneuten Startversuch unendlich hinaus. Aber irgendwann klappt es dann.
Beim nächsten Mal steht der LKW total im Wasser, die Räder sind fast nicht mehr zu sehen. Außerdem ist der Chauffeur so „geschickt“ an den Rand gefahren, dass das Gerät fast umkippt. Ich geleite die señoras galant über eine Planke auf’s Trockene, und alle lachen sich erst einmal kaputt.
Irgendwann geht mir das Gelabere schrecklich auf die Nerven. Der Fahrer hat die unangenehme Angewohnheit, nach einen Loch, in dem der LKW droht steckenzubleiben, mit Karacho durch- und weiterzufahren, dass die abgestiegenen Passagiere endlos lange hinterherlaufen müssen. Bei dem letzten bajan los hombres! [alle Männer absteigen!] machen einige schon nicht mehr mit. Die auf dem LKW entwickeln einen komischen Humor, indem sie die, die hinterher laufen, lauthals verspotten: un poco mas atletismo! [Ein bisschen mehr Athletik!]
Angesichts des Ziels Huachacalla sind alle etwas entspannter, da nichts mehr schief gehen kann. Die Diskussion um den Fahrpreis ist demokratisch: Der Fahrer entwickelt seine Thesen und die Fahrgäste die ihren. Beide Theorien unterscheiden sich, aber man findet einen Kompromiss.
In Huachacallo erwartet uns eine Überraschung: die angeblichen padres [von denen uns die anderen Passagiere erzählen, weil es keine Unterkunft in dem Ort gab] entpuppen sich als belgische Entwicklungshelfer mit zwei Kindern, die in einem netten Häuschen in einheimischen Stil leben und uns mit Spinat und selbst gebackenem Brot bewirten.

Unsere „Herberge“ in Huachacalla, bisher unveröffentlicht. Ich kann leider nicht mehr sagen, ob das Foto nicht vielleicht seitenverkehrt ist.
Einen Tag entspannen wir uns, waschen und inspizieren den Ort, was allerdings nur eine Viertelstunde dauert. Das einzige größere Gebäude ist die Kaserne, die wie aus einem Fremdenlegionärsfilm entsprungen aussieht.
Die Diskussion mit den beiden Entwicklungshelfern hinterlässt bei mir einen seltsamen Nachgeschmack. Man hat sich wenig zu sagen. Der Abschied am nächsten Morgen ist mehr oder weniger desinteressiert. Wir erfahren aber, dass die Urus und die Leute aus Chipaya dieselben sind.
[Anmerkung: Urus gibt es heute weniger als 2.000 – die Bewohner der Inseln des Titicacasees und der umliegenden Region sind meistens Aymara und nicht die Ureinwohner. Die Sprache der Urus, von ihnen selbst Puquina genannt, existiert fast nur noch nur noch in Chipaya. Deshalb ist der Ort außergewöhnlich exotisch und ohnehin nur einigen wenigen Experten bekannt. „Puquina itself is often associated with the culture that built Tiwanaku.“ Die Inkas eroberten die Gebiete der Aymara und Uru-Chipaya unter Huayna Capac (der Sohn des berühmten Túpac Yupanqui).]
Vor der inkaischen Eroberung bevölkerten die Uru-Chipaya die Flusstäler und die Seen – den Titicaca- und den Poopó-See [vermutlich auch die Ufer der Seen südlich von Chipaya, die heute Salzwüste sind]. Irgendwann seien die Seen ausgetrocknet. Die Kenntnisse über Wassertechniken hätten die Uru-Chipaya aber behalten. Die Aymara hingegen stammten – einer These zufolge – aus Ecuador und „würden nie Kanäle bauen“ wie die Leute aus Chipaya. Ein großer Teil der Urus seien heute Pentecostals.

Huachacalla
Am Morgen verfehlen wir den richtigen Weg und quälen uns erst einmal über die Hügel mit den schweren Rucksäcken. Der Marsch wird zur Strapaze, und B. ist völlig fertig. Unter „Heulen und Zähneklappern“ marschieren wir die 17 Kilometer [nach Escara – die erste Etappe des zweitägigen Marsches].
Einmal erschrecken wir uns zu Tode, als ein Gewehr in unserer Nähe durchgeladen wird. Zwei Soldaten tauchen auf und fragen uns, wohin wir wollten, lassen uns aber laufen.
Escara erscheint uns wie das gelobte Land, obwohl es nur ein winziges staubiges Nest am Fuß der Berge ist. Bei einer taller de bicicletas können wir in der Werkstatt übernachten und kochen uns leckere Süppchen und Tortillas.
Die Diskussion über einen Fahrradverleih gestaltet sich unbefriedigend, und endlich lehnen wir ganz ab. [Anmerkung: Das Weiße auf den Fotos – das Salz – ist bretthart, man kann darauf Fahrrad fahren, allerdings wäre eher ein Mountain-Bike mit guten Stoßdämpfern empfehlenswert, weil die Dellen im Salz einen vom Rad katapultieren würden, führe man nicht sehr langsam.]
Der señor, der Inhaber der Werkstatt, ist ein ganz Linker und fragt uns erst über unsere Meinung über die Malvinas aus. Irgendwie schwanken auch die Auskünfte darüber, wie viele Touristen schon hier waren, beträchtlich. Er kann sich an keine erinnern, jedenfalls sind wir in diesem Jahre die ersten.
Am nächsten Morgen packen wir unsere Rucksäcke um, lassen alles, was überflüssig ist, in der Werkstatt und düsen dann mit einem kleineren Rucksack los – 26 Kilometer Fußmarsch erwarten uns!



Die Fotos sind nach Südwesten aufgenommen worden. Man kann die schneebedeckten Anden von Chile erkennen. Es dürfte sich um den heutigen Parque Nacional Volcán Isluga handeln. Die einzelnen Berge kann ich leider nicht identifizieren. Im „Vordergrund“ Chullpas – Grabstätten der Aymara.
The Uru Chipaya is one of the most ancient people of South America, originating from 1500-2000 B.C. In the 16th century, the Uru Chipaya represented a quarter of the Altiplano Andean population. Nowadays, their territory represents a mere 920 km2, and the Uru Chipaya population counts little more than 2 000 individuals. The Uru Chipaya live in the Bolivian Altiplano bordering the salt desert of Coipasa,  at an altitude of 3640 m. Their territory is organized in 4 ayllus (or communities): Unión Barras, Aranzaya, Manazaya and Wistrullani. The traditional habitat consists of a group of circular houses built with mud and straw. One house serves as kitchen, another one as room, and so on and so forth.
at an altitude of 3640 m. Their territory is organized in 4 ayllus (or communities): Unión Barras, Aranzaya, Manazaya and Wistrullani. The traditional habitat consists of a group of circular houses built with mud and straw. One house serves as kitchen, another one as room, and so on and so forth.
Erst geht der Weg durch Halbwüste mit hohen Pampagras-Büscheln und schneebedeckten Bergriesen im Hintergrund, die vermutlich schon zu Chile gehören. Überraschend schnell gelangen wir zum ersten Fluss, wo wir zuerst nicht wissen, wie wir ihn überqueren sollen. Hinter uns kommt ein einsamer Radfahrer ohne jegliches Gepäck, der uns die beste Furt zeigt. Das Wasser geht nur bis über die Knie, obwohl es tiefer aussieht. [Es war Trockenzeit.]
Danach wird die Gegend öde, alles flach, mit weißen salzigen Stellen und kaum Bewuchs. In der Ferne Estancias mit runden und spitzen Vorratshäusern und riesigen Schaf- und Llama-Herden.
Einige freundliche Uros überholen uns auf dem Fahrrad, unter anderem auch der alcalde von Chipaya, ein netter Opa. Die Männer tragen alle einen braun-weiß gestreiften Poncho, der von einem Gürtel zusammengehalten wird, dass er wie ein Kleid aussieht, eine bunte Mütze mit Ohrschützern und darüber noch eine helle spitze Mütze.
Die Frauen sehen fantastisch aus: ein dunkelbraunes Baumwollkleid mit vielen Sicherheitsnadeln, die Haare im Afro-Look, hunderte von Knötchen, die in zwei Zöpfe auslaufen, die auch noch einmal zusammengeknotet sind. Einige tragen noch eine Art Kopftuch. (…)
Es gibt zwei ayllus mit je rund 500 Mitgliedern, daher auch zwei Bürgermeister (alcalde) und noch einen corregedor. In einem oficina, gleichzeitig die Schule, können wir übernachten.
Zum Glück erwischen wir gerade die Zeit des Brotbackens, sogar refrescos gibt es. Die Frauen erwarten offenbar, dass wir fotografieren und entspannen sich erst, als sie merken, dass wir das nicht tun. Wir haben noch eine nette Unterhaltung mit einem älteren Mann und der Lehrerin [es gab nur eine].
Am Morgen gibt es nur Wasser, was eklig schmeckt, und unsere eiserne Reserve Müsli. Im ganzen Dorf existiert nur ein Brunnen. Die Häuser am Dorfrand sind rund und ohne Fenster, mit Schilfdach. Die Estancias haben mehrere Rundhäuser, und verstreut über die Pampa sehen wir viele kaputte Plumpsklos. Wir entwickeln die Theorie, dass die runden Häuser einfach ein traditioneller Abklatsch der runden Schilfhäuser der Urus sind.
Der zweite alcalde, der nicht – wie sein „Kollege“ – die traditionelle Kleidung trägt, erwartet wohl, dass wir für das alojamiento bezahlen, was wir aber nicht tun. Der corregedor ist gerade in einer lautstarken Versammlung, und man bedeutet uns, dass er keine Zeit habe [wir wollten ihn um eine Erlaubnis zu fotografieren bitten]. So entschließen uns kurzerhand, das Dorf zu verlassen. Leider werden wir nie erfahren, ob sie sich wegen der verpassten Chance, etwas zu verdienen, geärgert haben.


Der Friedhof von Chipaya ist auch via Google Maps noch gut zu erkennen. Am Fuße der Berge im Hintergrund liegt der winzige Ort Escara, vom dem aus wir losmarschiert waren.
Auf dem Weg zurück nach Escara quäle ich mich bis fast zur totalen Erschöpfung. Zum Glück treffen wir kurz hinter einem Fluss einen LKW, der bis nach Oruro fährt. Wir sitzen auf toten Schafen in Säcken. In Escara holen wir unsere Sachen und warten ein paar Stunden. Dann geht es am späten Nachmittag los.
Es soll fast eine wieder Sumbay-Nacht werden. Der Fahrer kennt sich besser aus als der bei der Hinfahrt: Kurz vor dem endgültigen Steckenbleiben schaltet er immer den rettenden Rückwärtsgang ein. Irgendwo in einem winzigen Dorf bleibt er stehen. Ich friere total, selbst der Schlafsack hilft wenig. Außerdem gerate ich bei jeder Bewegung mit B. aneinander, hinten drücken die Schrauben der Seitenwand mir ins Kreuz und unten der Rucksack oder die toten Schafe. Ich kann kaum den Sternenhimmel genießen.
Am Morgen fährt der der LKW bis zu einer kaputten Brücke kurz vor Toledo. Es wird nur sehr langsam warm. Beim Marsch von der Fähre bis nach Toledo knickt B. um, und ich breche fast zusammen. Gegenseitig ermuntern wir uns. Auf der Plaza des Ortes erwarten uns eine köstliche Quinoa-Suppe und ein Bus, weil die Straße nach Oruro wieder halbwegs passierbar ist. Mir wird beim Essen schwindelig, und als ich im Bus sitze, kann ich mich kaum bewegen. Der Busfahrer will nicht losfahren, weil noch mehr pasageros kommen könnten. Wenn ich nicht so kaputt gewesen wäre, hätte ich mich geärgert. So spotten wir nur über ihn (…). Unter totaler Ruckelei kommen wir endlich in Oruro an.