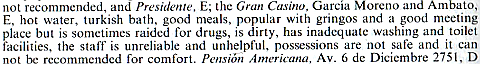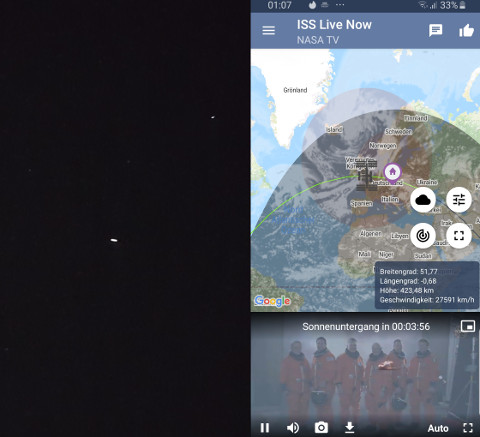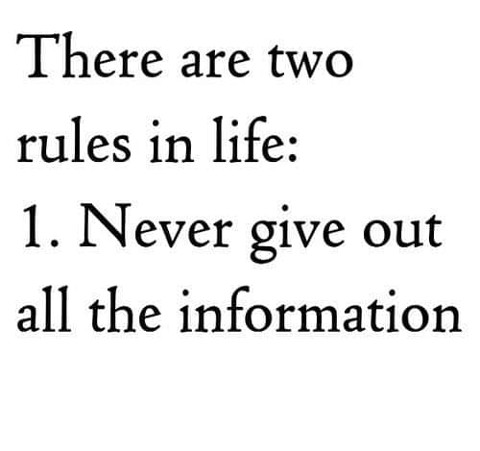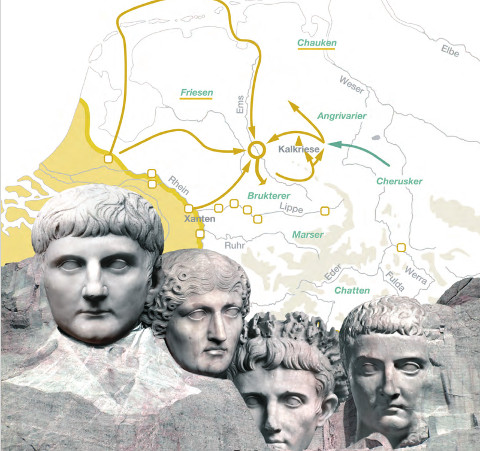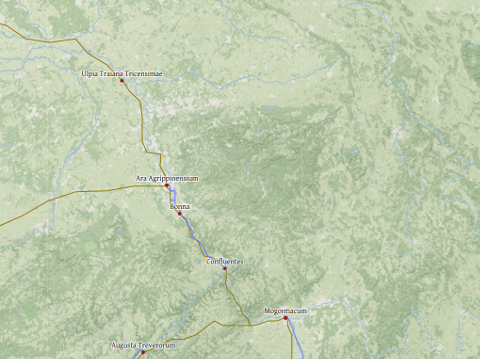Ein Nachtrag zu Cabanaconde, damals noch ein winziges Bauerndorf, eine Tagesreise nördlich von Arequipa, in den peruanischen Anden (1984). Mehr Fotos im April 2011: „Valle de Colca“.
Aus meinem Reisetagebuch, 24. März 1894, Juliaca:
Mit der Fahrt nach Cabanaconde fing die Reise erst richtig an, obwohl wir schon rund einen Monat unterwegs sind, nicht vom Gefühl her, sondern von der Intensität der Eindrücke. Wenn es nicht regnen würde, wäre alles vielleicht schöner und angenehmer, aber die Stimmung ist irgendwie authentischer.
Unser Hotelzimmer [in Juliaca], in einem ehemals großzügigen und vornehmen Hotel am Hauptplatz, jetzt total abgewrackt und baufällig. Die Wasserleitungen laufen außen an den Fluren entlang, die Waschbecken sind undicht, eine Glühbirne an der Decke beleuchtet unsere Wäscheleine und die Strümpfe daran, ein Schrank, dessen eine Tür abgebrochen ist und außen vorlehnt, die beiden Fensterflügel zur Plaza sind mit Latten von innen vernagelt – wohl weil der Balkon nicht sicher ist, feuchte Fußbodenbretter, überall ist der Putz heruntergefallen, und wir meditieren darüber, wie man mit den einfachsten Mitteln oder sogar nur mit gutem Willen vieles reparieren könnte.
Von Arequipa aus geht die Fahrt erst Richtung Küste durch endlose Steinwüsten. Wieder rollen von links die grauen Wanderdünen Richtung Straße, die ihr vorläufiges Ende bedeutet. Irgendwann biegt die Route nach Norden ab. Einige Bewässerungskanäle sorgen für ein bisschen Vegetation. Was könnten die Leute alles mit der Nutzung von Sonnenenergie anfangen!
Die Schotterstraße führt durch Sandwüste, wir bleiben einmal im Sand stecken. Ein irrer Gegensatz: Wenig später schraubt sich die Straße in endlosen Serpentinen bis in eine so hohe Zone hinauf, dass der Nebel alles bedeckt.
Wir passieren Huambo [3332 m], wo zum ersten Mal ein „Andendorf“ auftaucht. Die Leute starren uns an, schrecklich ärmlich, die Frauen in Tracht, aber der Eindruck ist noch wie im Zoo – so ein Widerspruch zu Arequipa.
Spät in der Nacht kommen wir nach einer haarsträubenden Fahrt an Abgründen entlang in strömendem Regen an. Der Nebel ist so dicht, dass man die andere Seite der Plaza [von Cabanaconde] nicht erkennen kann. Taschenlampen irren durch die Gegend. Das Wasser rauscht in Bächen überall entlang.
Es gibt nur ein alojamiento, mit Schlafsaal, das als die Unterkunft mit dem fürchterlichsten Klo in die Reiseannalen eingehen wird. In einem höhlenartigen „Restaurant“ gibt es noch ein cena, und wir kommen nicht darum herum, noch eine drittes „Abendessen“ für den Hotelchico [Der Junge, der in der Nacht der „Manager“ war] auszugeben. Der chico ist total nervig, folgt uns auf Schritt und Tritt und will mehr Geld. Wir trinken im Dunkeln auf der Plaza noch einen Kakao im Stehen und quatschen mit den Frauen dort.
Zum Klo muss man zehn Meter durch einen total verschlammten Hof. Das baño besteht aus eine windschiefen Hütte, überall steht Gerümpel herum, der Fußboden ein Matsch, das Klo nur ein runder Hohlstein mit einem hölzernen Deckel, natürlich total vollgeschissen. Keiner von uns beiden schafft es in den drei Tagen, sich richtig zu erleichtern. Das „Hotel“ besteht aus mehreren Lehmziegelhütten, teilweise mit Wellblech oder Stroh gedeckt, wie die meisten Häuser des Ortes. Die Leute kochen im Hof, mitten im Müll, in einem rußigen Top, daneben liegt ein blutiges Schaffell. Im ganzen Ort gibt es kein elektrisches Licht.
Trotz der Unannehmlichkeiten merkt man, dass Cabanaconde für viele Dörfer in der Sierra repräsentativ ist, für die traurigen, resignative Stimmung. Nur einige Frauen verändern das Bild zum Positiven. Die meisten tragen Tracht: Sandalen, lange Röcke, einige dunkelblau mit bestickten Säumen, ein Hemd, darüber eine reich verzierte Weste, ein Wickeltuch um die Hüfte, was seitwärts herunterhängt, und eine Decke zum Umhängen, zwei oder mehr Zöpfe und einen bestickten Hut.
Einige Frauen sehen recht selbstbewusst aus, und fotografieren geht leider nicht. Die Männer sind kaum zu sehen, aber einige Betrunkene bevölkern tagsüber die Plaza. Ab und zu treiben Bauern ihre Schafe und Ziegen durch den Ort. Ihre Kleidung besteht oft nur aus Fetzen.
Frühstück: Eine Tasse Kaffee und ein Brötchen. Am ersten Morgen wachen wir auf und sehen einen riesigen schneebedeckten Sechstausender [den Hualca Hualca] – ein atemberaubender Anblick. Die Dorfstraßen sind so eng, dass bis auf eine [vgl. Foto ganz oben] kein Auto durchkäme, in der Mitte ein Ablauf, ansonsten mit dicken Steinen teilweise „gepflastert“. Von oberhalb des Ortes kann man sehen, dass in einigen Teilen viele Häuser verlassen sind.
Am Nachmittag geraten wir in eine Hochzeit: Man winkt uns hinein. Ungefähr ein Dutzend Leute in Tracht, behängt mit Früchten, vor allem Zwiebeln, und geschmückten Hüten und eine stark angetrunkene Kapelle, die entsprechende Weisen vorträgt. Wir werden zu Schnaps genötigt. Die Braut, auch schon sehr angeheitert, will sich halb im Ernst mit mir verloben, aber die Vortänzerin [hinten rechts auf dem Foto] hat alles im Griff.
Der Bräutigam bringt kaum ein Wort heraus. Einer der Männer fällt in den Schlamm und steht nicht mehr auf. Eine uralte Frau mit weißen Haaren, sehr würdevoll, begrüßt uns sitzend auf Quechua. Sie spricht kein Spanisch.
Endlich bewegt sich die ganze Gesellschaft durch das Dorf zum Haus des Bräutigams, wo wir zu Suppe – mit einigen Kohlblättern – sowie Schnaps und Chicha aufgefordert werden. Wir unterhalten uns vor allem mit einem älteren Izquierdista, der alle Alemanes über den grünen Klee lobt und auf die Amis schimpft.
Männer und Frauen sitzen getrennt. Auf einem Teller liegt Geld, und jeder Betrag [der spendenden Gäste] wird mit Namensnennung auf einem Zettel vermerkt, speziell unsere deutsche Mark wird gesondert diskutiert. [Anmerkung: Ich war in einem Dilemma – die Maximalspende der Gäste war umgerechnet eine Mark wert; hätte ich weniger gegeben, hätten sie von mir gedacht, dass ich als reicher Gringo ein Geizhals wäre. Hätte ich aber wesentlich mehr gegeben, hätte das den Leuten ihre Armut demonstriert und wäre auch beleidigend gewesen. Ich hab dem Brautpaar also eine Mark und erklärte ihnen, wieviel diese umgerechnet in peranischen Soles wert war. Manche der Gäste konnten nur ein paar Zwiebeln oder einen Kohlkopf schenken.
Was nicht in meinem Tagebuch steht, was ich aber nie vergessen werde: Die größte Sensation war, als ein sehr alter Mann den Raum betrat und, da kein Platz frei war, ich aufstand und ihm sagte, ich sei jung und er solle sich bitte auf meinen Platz setzen. So etwas erwarteten sie offenbar übehaupt nicht. Der Mann tat es und murmelte ständig vor sich hin, was ich für ein „komischer“ Gringo sei – für einen Bauern aufzustehen. Die Männer wollten umgehend eine Kommission zusammenstellen, die uns in die grandiose Schlucht [Colca-Canyon – der dritttiefste Caynon der Welt] führen sollte, damit noch mehr Touristen kämen. Wir waren wohl die ersten. Zum Glück waren alle so betrunken, dass es sie diesen Plan wieder vergaßen – sie wären wohl alle in die Schlucht gestürzt. Der Mirador de Achachihua, den man heute dort sehen kann, könnte ein Resultat dieses Plans sein, den irgendwann irgendjemand umgesetzt hat.]
Wir schaffen uns kaum, uns zu verabschieden: Der Bräutigam, nur noch flüsternd, ist so gerührt, dass er in Tränen ausbricht und uns ständig umarmt. Um sechs Uhr verlassen wir die Feierlichkeiten, nur um festzustellen, dass die Señora unserer Unterkunft doch nichts gekocht hat. Unregelmäßig wird abends auf der Plaza Essen verkauft, fast nur Kohlenhydrate. Wir haben Glück.
Ab drei Uhr Nachmittags regnet es jeden Tag, und später wird der Nebel undurchdringlich dicht. Wir gehen zwischen sieben und acht ins „Bett“, weil man ohnehin nichts unternehmen kann.